Bundestag: Spahn-Vorstoß zu Umgang mit AfD stößt auf Widerstand
Berlin - Die Jusos wollen Nachverhandlungen, die SPD-Führung verteidigt den Koalitionsvertrag. Seit Dienstag können fast 360.000 Parteimitglieder abstimmen.
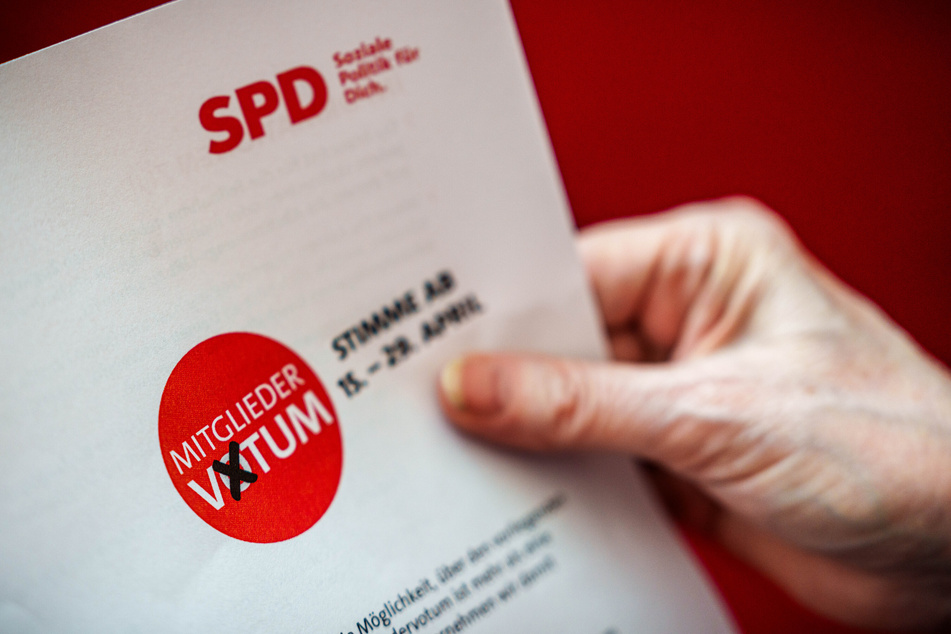
Zwei Wochen haben die Mitglieder der SPD Zeit, über den Koalitionsvertrag mit der Union abzustimmen. Am 30. April soll das Ergebnis bekanntgegeben werden.
Parteichefin Saskia Esken (63) warb in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur um Zustimmung zu dem 144 Seiten starken Vertragswerk.
Auch sie sehe darin zwar einiges an "Licht und Schatten". Die Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungszwecke, das Sondervermögen für Investitionen und die Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft hob Esken aber als gute Grundlage für eine Zusammenarbeit zwischen Union und SPD hervor. "Ich gehe davon aus und hoffe, dass wir eine gute Zustimmung bekommen."
Alle wichtigen Infos zur Bundestagswahl und der Regierungsbildung findet Ihr im TAG24-Ticker.
16. April, 8.14 Uhr: Spahn-Vorstoß zu Umgang mit AfD stößt auf Widerstand
Der Vorstoß von Unionsfraktionsvize Jens Spahn (44, CDU), mit der AfD bei organisatorischen Fragen im Bundestag so umzugehen wie mit anderen Oppositionsparteien, sorgt für Unmut beim potenziellen Regierungspartner SPD.
"Die AfD ist keine Partei wie jede andere", sagte Katja Mast (54), Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, dem "Tagesspiegel". "Wir werden unsere demokratischen Institutionen - allen voran unser Parlament - mit aller Entschlossenheit schützen."
Die AfD versuche, "unsere Institutionen zu untergraben", sagte Mast. "Dieser Extremismus stößt auf unseren entschiedenen Widerstand."

15. April, 13.41 Uhr: Esken will mehr Frauen als Männer aus der SPD im Kabinett
SPD-Chefin Saskia Esken hat sich dafür ausgesprochen, dass die SPD mehr Frauen als Männer in das neue Bundeskabinett schickt.
In einem Interview der Deutschen Presse-Agentur forderte sie, dass vier der sieben SPD-Posten von Frauen besetzt werden. "Frauen stellen die Hälfte der Bevölkerung und wir wollen auch, wie wir manchmal sagen, nicht nur den halben Kuchen, sondern die halbe Bäckerei."
Auf die Frage, ob das vier Posten für die SPD-Frauen bedeuten wird, sagte sie: "Wenn man rechnen kann, ja, dann kommt man auf vier."

15. April, 13.41 Uhr: CDU-Generalsekretär Linnemann will nicht Minister werden
CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann (47) will kein Minister in der möglichen neuen Bundesregierung aus Union und SPD werden.
Eine entsprechende Meldung der "Bild"-Zeitung wurde der Deutschen Presse-Agentur in Parteikreisen bestätigt. Linnemann will CDU-Generalsekretär bleiben. Zuvor war spekuliert worden, Linnemann könne neuer Bundeswirtschaftsminister werden.

15. April, 9.16 Uhr: Umgang mit AfD - Kretschmer und Amthor springen Spahn bei
Unionsfraktionsvize Jens Spahn (44, CDU) bekommt für seinen Vorschlag, mit der AfD bei organisatorischen Fragen im Bundestag so umzugehen wie mit anderen Oppositionsparteien, Zuspruch aus seiner Partei.
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (49) sagte im ZDF-"Morgenmagazin": "Die AfD ist eine rechtsextreme Partei, sie will die Demokratie abschaffen." Mit ihr könne es keine Zusammenarbeit und keine Koalition geben. Man müsse die AfD mit Sachpunkten stellen. Die eigentlichen demokratischen Rechte für jeden Abgeordneten sollten aber auch für diese Partei gelten, "weil man ansonsten sie stark macht und nicht schwächt."
Spahn hatte in der "Bild" vorgeschlagen, die AfD bei Abläufen im Parlament, Verfahren in der Geschäftsordnung, in den Ausschüssen und der Berücksichtigung von Minderheits- und Mehrheitsrechten zu behandeln wie jede andere Oppositionspartei.
Auch der CDU-Politiker Philipp Amthor (32) nahm Spahn gegen Kritik in Schutz. Spahn sei es doch "ganz offensichtlich nicht um eine Bagatellisierung der AfD" gegangen, sondern "um den berechtigten Hinweis, dass man diese Truppe anstatt durch parlamentsrechtliche Kniffe besser durch eine leidenschaftlich-inhaltliche Auseinandersetzung zurückdrängen sollte", sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

15. April, 8.35 Uhr: SPD-Abstimmung über Koalitionsvertrag hat begonnen
Die Abstimmung der SPD-Mitglieder über den Koalitionsvertrag mit der Union hat begonnen.
Wie geplant wurde um 8 Uhr die Online-Plattform freigeschaltet, auf der die gut 358.000 Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten bis zum 29. April um 23.59 Uhr ihre Stimmen abgeben können, wie ein Parteisprecher mitteilte. Am 30. April soll das Ergebnis bekanntgegeben werden.
15. April, 7.16 Uhr: Gewerkschaftsbund wehrt sich gegen längeren Arbeitstag
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hält nichts davon, eine längere tägliche Arbeitszeit zu ermöglichen.
Das Arbeitszeitgesetz müsse ein Schutzgesetz für die Gesundheit der Beschäftigten bleiben, sagte die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi (57) der "Augsburger Allgemeinen". Bei den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD sei es "zur politischen Verhandlungsmasse geworden, was ein schwerer Fehler ist".

14. April, 20.45 Uhr: SPD-Chef Lars Klingbeil warnt
Vor dem Start des SPD-Mitgliedervotums über den Koalitionsvertrag mit der Union hat die Parteispitze eindringlich um Zustimmung geworben und vor einem Scheitern gewarnt.
"Ich möchte, dass wir uns nicht wegducken, und ich möchte, dass wir die Zukunft dieses Landes gestalten", sagte Parteichef Lars Klingbeil (47) auf einer Dialogkonferenz in Hannover. Zuvor hatten sich der Juso-Bundesvorstand und mehrere Landesverbände der Parteijugend wegen der Migrations- und Sozialbeschlüsse klar gegen den Koalitionsvertrag gestellt und Nachverhandlungen gefordert.
Klingbeil entgegnete, dass diese Rechnung nicht aufgehen werde. "Wenn das scheitert, dann wird es Neuwahlen geben, oder dann wird es vielleicht eine Minderheitsregierung geben." Nachverhandlungen werde es aber nicht geben. Stattdessen bestehe die Gefahr, dass die Kräfte in der Union gestärkt werden, die für eine Normalisierung des Verhältnisses zur AfD sind. "Wenn wir scheitern, dann werden die lauter."

14. April, 13.22 Uhr: Termin für Kanzlerwahl steht
CDU-Chef Friedrich Merz (69) soll am 6. Mai vom Parlament zum Bundeskanzler gewählt werden.
Das teilte der Bundestag mit. Voraussetzung ist die Zustimmung von CDU, CSU und SPD zum Koalitionsvertrag.

14. April, 11.40 Uhr: Juso-Führung sagt Nein zu Koalitionsvertrag
Unmittelbar vor Beginn des SPD-Mitgliedervotums über den Koalitionsvertrag mit der Union hat sich die Parteijugend klar dagegen positioniert.
"Unser Votum lautet Ablehnung", sagte der Vorsitzende der Jungsozialisten, Philipp Türmer (29), in der Sendung "Frühstart" von RTL und ntv. "Für die Zustimmung der Jusos bräuchte es deutliche Nachbesserungen." Zu dieser Haltung sei der Bundesvorstand in enger Abstimmung mit den Landes- und Bezirksverbänden gekommen.

14. April, 6.17 Uhr: SPD-Führung wirbt um Zustimmung zu Schwarz-Rot
SPD-Chef Lars Klingbeil (47) wirbt vor dem Start des Mitgliedervotums zum Koalitionsvertrag um Zustimmung für eine schwarz-rote Bundesregierung.
"Dazu gehört dann auch ein Kanzler Friedrich Merz - und ich traue ihm zu, dass er unser Land in diesen schwierigen Zeiten gut führen wird", sagte Klingbeil in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Von Dienstag an und bis zum 29. April können alle gut 358.000 SPD-Mitglieder über den Koalitionsvertrag abstimmen.

12. April, 17.06 Uhr: Neue Bundesregierung soll am 6. Mai ihre Arbeit aufnehmen
Der designierte Bundeskanzler Friedrich Merz (69, CDU) kündigte im "Handelsblatt" an, dass die neue Bundesregierung am 6. Mai ihre Arbeit aufnehmen soll.
Bevor Merz zum Kanzler gewählt werden kann, müssen die SPD-Mitglieder sich in einer vom 15. bis 29. April geplanten Befragung sowie die CDU auf ihrem am 28. April geplanten kleinen Parteitag für den von Union und SPD ausgehandelten Koalitionsvertrag aussprechen. Die CSU-Gremien hatten diesen bereits am Donnerstag gebilligt.

12. April, 12.36 Uhr:Bürokratieabbau bringt angeblich Einsparung von 26 Milliarden Euro
Unternehmen und Bürger könnten durch den im schwarz-roten Koalitionsvertrag geplanten Bürokratieabbau nach Angaben aus der Union mindestens 26 Milliarden Euro sparen.
Allein die Reduzierung von Melde- und Berichtspflichten für die Wirtschaft mache 16 Milliarden Euro im Jahr aus, sagte der Unions-Abgeordnete Hendrik Hoppenstedt (52) der Deutschen Presse-Agentur. "Damit wird diese Art von Bürokratiekosten um 25 Prozent gesenkt." Dazu kämen weitere Maßnahmen im Volumen von zehn Milliarden Euro im Jahr, von denen zum Teil auch die Bürger direkt profitierten.
12. April, 10.38 Uhr: SPD-Frauen wollen Esken als Parteichefin oder Ministerin
Frauen in der SPD wollen Saskia Esken (63) weiter als Parteichefin haben - oder sie als Ministerin sehen.
"Natürlich wäre es gut, bliebe Saskia Esken unsere Parteivorsitzende. Aber natürlich ist sie auch für ein Ministeramt geeignet und bestens vorbereitet", sagte die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der SPD-Frauen, Maria Noichl, dem "Tagesspiegel".

12. April, 10.24 Uhr: Spahn für anderen Umgang mit AfD im Bundestag
Unionsfraktionsvize Jens Spahn (44, CDU) rät dazu, mit der AfD bei organisatorischen Fragen im Bundestag so umzugehen wie mit anderen Oppositionsparteien auch.
Spahn sprach in der "Bild" von Abläufen im Parlament, Verfahren in der Geschäftsordnung, in den Ausschüssen und der Berücksichtigung von Minderheits- und Mehrheitsrechten. "Da würde ich einfach uns empfehlen, mit der AfD als Oppositionspartei so umzugehen in den Verfahren und Abläufen, wie mit jeder anderen Oppositionspartei auch."
12. April, 8.50 Uhr: Rentenpläne kosten 50 Milliarden Euro
Die Pläne von Union und SPD für ein stabiles Rentenniveau und bessere Mütterrenten kosten nach Berechnung der Arbeitgeber bis 2031 rund 50 Milliarden Euro.
"Der Koalitionsvertrag lässt leider jegliche Anstrengungen vermissen, das Ausgabenwachstum in der Rentenversicherung zu begrenzen", sagte der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, der Deutschen Presse-Agentur.
12. April, 8.47 Uhr: Koalitionsvertrag laut Queer-Beauftragten "große Nullnummer"
Der Queer-Beauftragte der scheidenden Bundesregierung, Sven Lehmann, warnt mit Blick auf den schwarz-roten Koalitionsvertrag vor Rückschritten für seine Community.
Der Vertrag sei für queere Menschen "eine große Nullnummer", sagte Lehmann der Deutschen Presse-Agentur. "Die Fortschritte und Erfolge der letzten Jahre dürfen von der neuen Bundesregierung nicht zurückgedreht werden."

12. April, 8.43 Uhr: "Jede Ausgabe auf ihre Sinnhaftigkeit überprüfen" - sagt Spahn
Unionsfraktionsvize Jens Spahn (44) hat Sparanstrengungen der voraussichtlichen schwarz-roten Regierungskoalition angemahnt.
"Wir müssen noch sehr, sehr stark konsolidieren. Und wir müssen uns auch die Freiräume erarbeiten für die Reformen, die wir vorhaben", sagte der CDU-Politiker der "Bild"-Zeitung.
11. April, 7 Uhr: Koalitionsverhandlungen standen kurzzeitig vor dem Aus
Die Verhandlungen von Union und SPD über die künftige Koalition drohten in der Schlussphase noch zu scheitern.
"Es gab tolle Momente. Der vergangene Montag war eher schwierig, da stand die Koalition auf der Kippe", sagte CDU/CSU-Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei (51) dem "Tagesspiegel". CDU, CSU und SPD hatten im Mittwoch eine endgültige Einigung erzielt und ihren Koalitionsvertrag vorgelegt.

11. April, 6.57 Uhr: Schwarz-Rot will bis Sommer andere Stimmung im Land schaffen
Die angestrebte Koalition aus Union und SPD will mit einem Sofortprogramm an Maßnahmen bis zum Sommer einen Stimmungsumschwung schaffen.
In den ersten zehn bis zwölf Wochen nach der Wahl des CDU-Chefs Friedrich Merz (69) zum Kanzler Anfang Mai sollten die vorrangigsten Aufgaben angegangen werden, sagte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann (47) am Abend in der ZDF-Sendung von Maybrit Illner (60). Ziel sei, dass "es auch in der Sommerpause schon mal eine andere Grundstimmung in Deutschland gibt".

10. April, 20.54 Uhr: Krankenkassen fordern von Union und SPD Strukturreformen im Gesundheitswesen
Die gesetzlichen Krankenkassen (GKV) sehen das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen von Union und SPD nur in Teilen positiv.
Bei Gesundheit und Pflege würden "einige gute Impulse gesetzt", erklärte der BKK Dachverband. Auf die großen Herausforderungen wie die Stabilisierung der prekären Finanzlage oder die Pflegekrise gebe es im Koalitionsvertrag jedoch "keine adäquaten Antworten". Der Vorstandsvorsitzende des BKK Dachverbands, Franz Knieps (68), sprach von einem "Rumdoktern am System statt mutiger Erneuerung".
10. April, 17.23 Uhr: Union fordert von SPD Absage an jegliche Steuererhöhungen
CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt (54) verlangt von einer möglichen Finanzministerin oder einem möglichen Finanzminister der SPD eine generelle Absage an Steuererhöhungen.
"Steuererhöhungen sind mit uns nicht zu machen. Das haben wir der SPD auch deutlich gemacht, dass das nicht geht. Jeder wird sich daran halten müssen", sagte Dobrindt im Podcast des Nachrichtenportals "Table.Briefings"."Wir reden über Entlastungen in Deutschland und nicht über zusätzliche Belastungen", unterstrich der CSU-Politiker.

10. April, 16.09 Uhr: Söder hält an Klage gegen Länderfinanzausgleich fest
CSU-Chef Markus Söder (58) will die bayerische Klage gegen den Länderfinanzausgleich auch nach dem erfolgreichen Ende der Koalitionsverhandlungen von Union und SPD aufrechterhalten.
"Die Klage bleibt. Das ist eine grundsätzliche Frage", sagte der bayerische Ministerpräsident nach einer Sitzung des CSU-Vorstands in München.
10. April, 16.08 Uhr: Europäische Armee laut Bundespräsident kein Nato-Ersatz
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69) hält eine europäische Armee für keinen gleichwertigen Ersatz für die Nato.
"Wir haben dieser Nato viel zu verdanken. Sie steht im Augenblick in der Diskussion aufgrund von Entscheidungen, oder sagen wir besser, Ankündigungen, die wir aus Washington und dem Weißen Haus hören", sagte er bei seinem Besuch des Zentrums Innere Führung in Koblenz.
10. April, 15.04 Uhr: Söders CSU hofft auf schnelle Regierungsbildung
CSU-Chef Markus Söder (58) setzt nach der großen Zustimmung seiner Partei zum Koalitionsvertrag von Union und SPD auf eine schnelle Regierungsbildung.
"Wir hoffen auf ein gutes Gelingen", sagte der bayerische Ministerpräsident in München. Zuvor hatte der CSU-Vorstand in einer internen Sitzung mit den CSU-Bundes- und Landtagsabgeordneten den Koalitionsvertrag einstimmig gebilligt. Die Partei ist damit die erste, die das Vertragswerk abgesegnet hat.

10. April, 15 Uhr: Woidke rechnet mit Zustimmung zum Koalitionsvertrag
Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke (63) rechnet mit einem Ja seiner Partei zum Koalitionsvertrag mit der Union.
"Ich bin da - zumindest, was meine Partei betrifft - optimistisch, dass es eine Zustimmung gibt, weil natürlich die Herausforderungen für dieses Land groß sind", sagte Woidke. Deutschland brauche dringend eine handlungsfähige Bundesregierung - "gerade in einer Welt, die sich jeden Tag ein bisschen schneller zu drehen scheint und häufig in die falsche Richtung".
10. April, 14.55 Uhr: SPD und Union wiederholen laut Grünen-Fraktion Fehler der Ampel
Der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD enthält aus Sicht der Grünen-Fraktion zu viele ungeklärte Positionen und Finanzierungslücken.
Mit Blick auf die Finanzen zeige sich "genau der Fehler, den die Ampel in ihrer Regierungsbildung auch gemacht hat", sagte die Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge (40). Dadurch, dass viele der von Schwarz-Rot vereinbarten Maßnahmen unter Finanzierungsvorbehalt gestellt würden, verschiebe man den Streit über die Finanzierungsfragen in die Zukunft. "Dann ist der Streit vorgezeichnet und dann ist auch die Enttäuschung für die Menschen vorgezeichnet, weil mit diesem Koalitionsvertrag sind ja jetzt Erwartungen verbunden", fügte sie hinzu.
10. April, 14.53 Uhr: Söder rechnet mit Kanzlerwahl am 6. Mai
Die Wahl von Friedrich Merz (69) zum nächsten Bundeskanzler könnte laut CSU-Chef Markus Söder (58) am 6. Mai stattfinden.
Wenn alles nach Plan laufe, dann könne der Koalitionsvertrag von Union und SPD am 5. Mai unterschrieben werden, tags drauf könne Merz dann im Bundestag gewählt werden, sagte der bayerische Ministerpräsident nach Angaben von Teilnehmern in einer internen Sitzung des CSU-Vorstands in München. Erst nach der Wahl des Kanzlers würden dann die Namen der künftigen Minister bekanntgegeben.
10. April, 14.21 Uhr: CSU billigt schwarz-roten Koalitionsvertrag
Als erste der drei beteiligten Parteien hat die CSU den ausgehandelten Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD gebilligt.
Der einstimmige Beschluss fiel in einer Schalte von Parteivorstand, CSU-Bundes- und Landtagsabgeordneten, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr.

10. April, 10.40 Uhr: Abschiebeflüge nach Syrien und Afghanistan angekündigt
Die künftige Bundesregierung will nach Angaben von Unionsfraktionsgeschäftsführer Thorsten Frei (51) regelmäßige Abschiebeflüge nach Afghanistan und Syrien organisieren.
"Darauf können sich die Deutschen verlassen", sagte der CDU-Politiker der "Bild"-Zeitung. Der erste Flug im Spätsommer 2024 habe gezeigt, dass das funktioniere. "Deswegen sind wir davon überzeugt, dass wir das auch zukünftig, dauerhaft und in wesentlich größeren Bereichen auch hinbekommen."
Frei wies darauf hin, dass von den 240.000 Menschen, die in Deutschland vollziehbar ausreisepflichtig sind, knapp 200.000 eine Duldung hätten. "Sie müssen in jedem Fall das Land verlassen, und zwar eigentlich freiwillig. Denn es gab ein Asylverfahren, es gab im Zweifelsfall auch ein verwaltungsgerichtliches Verfahren. Das muss dann auch Konsequenzen haben."
Zugleich bekräftigte er, dass es Zurückweisungen an den deutschen Grenzen und Ausreisezentren geben solle. "Wir werden auch mit den Herkunftsländern anders sprechen. Es wird Konsequenzen haben, wenn man der völkerrechtlichen Verpflichtung nicht nachkommt."

10. April, 10.23 Uhr: Grüne über CSU-Chef - "Markus Söder war sehr flapsig"
Die Grünen-Co-Vorsitzende Franziska Brantner (45) hat den Auftritt von CSU-Chef Markus Söder bei der Präsentation des Koalitionsvertrags von Union und SPD kritisiert.
"Markus Söder war sehr flapsig, eigentlich mehr ein Showmaster. Angesichts dessen, was in der Welt gerade passiert, fand ich das nicht angemessen", sagte Brantner in einem Interview des Bayerischen Rundfunks (Bayern 2). "Das mag in einem Bierzelt lustig sein, aber wir sind jetzt wirklich in anderen Zeiten."
Söder hatte am Mittwoch bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages mehrfach für Gelächter gesorgt, unter anderem als er deutlich machte, dass es sich bei der schwarz-roten Koalition aus seiner Sicht nicht unbedingt um eine "Liebesheirat" handele - "trotz einer neuen Duz-Männerfreundschaft zwischen Friedrich Merz und Lars Klingbeil, die sich ganz zärtlich entwickelt hat". Dazu zitierte er die alte Bauernregel: "Liebe vergeht, Hektar besteht."

10. April, 6.49 Uhr: Wie die schwarz-roten Pläne auf dem Konto wirken
Ob Steuern, Rente, Bafög oder Förderprogramme: Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD geht es auf vielen Seiten ums Geld der Bürger.
Nach Berechnungen von Steuerexperten des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln enthält der Koalitionsvertrag Entlastungen in einem mittleren zweistelligen Milliardenbereich.
Zwar sind die Pläne oft noch nicht konkret genug für Vorhersagen auf Euro und Cent. Und alles steht unter dem Vorbehalt, dass genügend Geld da ist. Doch es zeichnet sich ab, wer profitiert, wer sparen könnte - und wer künftig eventuell auch schlechter dasteht.
- Einkommensteuer: Das ist noch die größte Unbekannte in der Rechnung. Union und SPD planen eine Steuerreform, die kleine und mittlere Einkommen entlastet - und zwar ab der Mitte der Legislaturperiode, also etwa in zwei Jahren. Doch genauer werden sie nicht: Wer genau künftig wie viel weniger abdrücken muss, ist völlig offen. Sicher ist dafür, dass die Pendlerpauschale steigt: Ab 2026 soll sie ab dem ersten Kilometer 38 Cent betragen - und nicht ab dem 21. Kilometer wie bisher.
- Rente: Ebenfalls im Jahr 2026 soll eine "Frühstart-Rente" eingeführt werden. Für jedes Kind vom 6. bis zum 18. Lebensjahr, das in Deutschland eine Schule oder andere Bildungseinrichtung besucht, fließen dann pro Monat zehn Euro in ein Altersvorsorgedepot. Wenn man erwachsen ist, soll man privat weiter einen bestimmten Betrag einzahlen können. Die Erträge aus dem Depot sollen bis zum Renteneintritt steuerfrei sein - ausgezahlt wird das Geld allerdings erst im Rentenalter.
Freiwillige Mehrarbeit: Künftig soll es sich lohnen, freiwillig mehr zu arbeiten - mit Überstunden oder auch im Rentenalter. Auf Zuschläge für Überstunden, die über die tariflich vereinbarte Vollzeitarbeit hinausgehen, soll man keine Steuern zahlen müssen. Menschen im Rentenalter, die freiwillig weiterarbeiten, sollen bis zu 2000 Euro monatlich steuerfrei erhalten können. Auch wer von Teilzeit auf Vollzeit aufstockt, soll steuerlich belohnt werden.
Familien mit Kindern: Wer nach der Geburt eines Kindes nicht oder nur wenig arbeitet und mit seinem Partner nicht zu viel verdient, hat Anspruch auf Elterngeld. Das könnte spürbar steigen, denn Union und SPD wollen sowohl den Mindestsatz als auch den Höchstbetrag angeben. Genaue Zahlen nennen sie aber nicht.
Hohe Mieten: Union und SPD wollen dafür sorgen, dass Vermieter sich besser an die Mietpreisbremse halten, also beim Umzug in eine beliebte Wohngegend nicht zu viel Miete verlangen. Dafür erwägen sie Bußgelder bei Verstößen.
Stromkosten: Dieser Plan soll vor allem die Industrie entlasten, es profitieren aber auch alle Bürger: Die Stromsteuer soll auf den in der EU erlaubten Mindestwert sinken, ebenso Umlagen und Netzentgelte. Dadurch könnte man mindestens fünf Cent pro Kilowattstunde sparen. Erdgas könnte durch die geplante Abschaffung der Gasspeicherumlage günstiger werden. Nach Berechnung des Portals Verivox könnte eine Familie im Einfamilienhaus mit Jahresverbrauch von 20000 Kilowattstunden rund 71 Euro sparen, ein Single-Haushalt mit Verbrauch von 5.000 Kilowattstunden rund 18 Euro.
Bafög: Union und SPD planen zum Wintersemester 2026/2027 eine Bafög-Erhöhung. Die Wohnkostenpauschale für Studenten, die nicht mehr bei den Eltern wohnen, soll von derzeit 380 auf 440 Euro im Monat angehoben werden. Außerdem soll der Grundbedarf, der aktuell bei 475 Euro im Monat liegt, in zwei Schritten an das Niveau der Grundsicherung angepasst werden: zum Wintersemester 2027/2028 und nochmal ein Jahr später.
Deutschlandticket: Das beliebte Pauschalticket für Busse und Bahnen soll es weiter geben - Fahrgäste müssen sich aber ab 2029 auf höhere Preise einstellen. Bereits zu Jahresbeginn war der Preis des Tickets für den bundesweiten Nahverkehr von 49 Euro auf 58 Euro im Monat angehoben worden. Was es ab 2029 kosten könnte, ist noch offen.
Führerschein: Viele junge Erwachsene können es sich kaum leisten, den Führerschein zu machen. Durch eine Reform der Fahrausbildung soll das wieder bezahlbarer werden. Wie sie das genau erreichen wollen, sagen Union und SPD allerdings nicht.
Flugtickets: Die Luftverkehrsteuer soll wieder gesenkt werden - das könnte sich auf die Preise für Flugtickets auswirken. Airlines hatten unter Verweis auf die höheren Kosten Flüge von deutschen Flughäfen gestrichen. Die Hoffnung könnte auch sein, dass bald wieder mehr Ziele angeflogen werden. Sicher ist das aber nicht.

10. April, 6.42 Uhr: SPD-Generalsekretär wirbt um Zustimmung
SPD-Generalsekretär Matthias Miersch (56) bat die Parteimitglieder um Zustimmung zu dem 144 Seiten starken Vertragswerk.
"Ich werbe für ein starkes Ja der SPD-Basis, damit wir gemeinsam Verantwortung übernehmen können. Wir haben viel herausgeholt: massive Investitionen in die Zukunft und den sozialen Zusammenhalt, in sichere Arbeitsplätze, bezahlbares Wohnen und einen handlungsfähigen Staat."
Die Parteimitglieder sollen in mehreren Veranstaltungen über den Koalitionsvertrag informiert werden. Am Tag vor Beginn des Votums findet eine sogenannte Dialogkonferenz in Hannover statt, am 26. April eine weitere in Baunatal bei Kassel. Zudem sind weitere kleinere Informationsveranstaltungen online und in Präsenz geplant.

9. April, 22.20 Uhr: SPD-Mitglieder entscheiden bis 29. April über Koalitionsvertrag
Die SPD-Mitglieder entscheiden bis 29. April über die Annahme des mit der Union ausgehandelten Koalitionsvertrags.
Die Befragung aller gut 358.000 Mitglieder beginnt am kommenden Dienstag, wie die Partei nach einem Vorstandsbeschluss vom Abend mitteilte. Sie endet mit Ablauf des 29. April.

9. April, 21.05 Uhr: Merz sichert Umsetzung von neuen Abschreibungsregeln zu
Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz (69) hat zugesagt, dass die geplanten Maßnahmen zur steuerlichen Entlastung von Unternehmen ungeachtet von Finanzierungsfragen umgesetzt werden.
"Ja, die Maßnahmen kommen", versicherte er auf eine entsprechende Nachfrage im ARD-"Brennpunkt". "Die deutsche Wirtschaft hält viel aus, aber was sie nicht aushält ist Ungewissheit, Unsicherheit - und die beseitigen wir."
9. April, 20.16 Uhr: Koalition will Selbstbestimmungsgesetz auf Prüfstand stellen
Die künftige schwarz-rote Koalition will das von der Ampel verabschiedete Selbstbestimmungsgesetz auf den Prüfstand stellen.
"Wir werden das Gesetz über die Selbstbestimmung im Bezug auf den Geschlechtseintrag bis spätestens 31. Juli 2026 evaluieren", heißt es dazu im Entwurf des Koalitionsvertrags von CDU, CSU und SPD, der noch der Bestätigung durch die Parteien in den kommenden Wochen bedarf.
9. April, 19.36 Uhr: Gespräche zu Zurückweisungen laufen laut Söder schon
Der CSU-Vorsitzende Markus Söder (58) stellt bereits zum Start einer schwarz-roten Bundesregierung eine massive Ausweitung der Grenzkontrollen in Aussicht.
Im Fernsehsender "Welt" versicherte der bayerische Ministerpräsident am Abend, die angepeilten Zurückweisungen an den deutschen Grenzen würden von einem Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vom ersten Tag an umgesetzt.

9. April, 18.57 Uhr: Ostbeauftragter künftig im Finanzministerium
Auch in der künftigen Bundesregierung soll es einen Beauftragten oder eine Beauftragte für Ostdeutschland geben, aber nicht mehr im Kanzleramt.
Die Position soll im Finanzministerium angesiedelt werden, wie es im Koalitionsvertrag von Union und SPD heißt. Besetzt werden soll das Amt weiter von der SPD.
9. April, 18.21 Uhr: Koalition will auf den Mond
Die voraussichtliche neue Bundesregierung will offensichtlich ziemlich hoch hinaus und nimmt dabei verstärkt das Weltall in den Blick.
So soll nicht nur das bisherige Bundesministerium für Bildung und Forschung zu einem Ministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt umgebaut werden, auch eine Mondlandung unter deutscher Beteiligung wird im Koalitionsvertrag von Union und SPD angestrebt.
"Astronautische Weltraummissionen inspirieren die nächste Generation zu Höchstleistungen. Wir streben an, dass eine deutsche Astronautin oder ein deutscher Astronaut im Rahmen einer internationalen Mission zum Mond fliegt", heißt es in dem Papier. Raumfahrt wird als Zukunfts- und Schlüsseltechnologie bezeichnet.
9. April, 18.12 Uhr: Schwarz-Rot heißt "Hoffnungslosigkeit" - heftige Kritik von links
Die Linke übt scharfe Kritik am Koalitionsvertrag von Union und SPD.
Dieser ignoriere Probleme wie hohe Mieten, hohe Preise, den bröckelnden Zusammenhalt der Gesellschaft und die Zerstörung des Planeten, sagte Parteichefin Ines Schwerdtner (35). "Komplett mutlos, fantasielos und ohne sozialen Kompass präsentiert sich hier diese Koalition der Ignoranz und der Hoffnungslosigkeit." Die Politik werde den Weg für rechte Parteien ebnen.
Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek () ergänzte, die Sicherung des Rentenniveaus auf 48 Prozent reiche nicht. "Das ist nichts anderes als eine Fortschreibung von Altersarmut", meinte sie. "Anstatt dieses Elend zu zementieren, muss das Rentenniveau endlich wieder auf 53 Prozent erhöht werden." Auch die Pläne zur Migrationspolitik kritisierte sie.

9. April, 17.58 Uhr: Grüne lassen kein gutes Haar am Koalitionsvertrag
Die Grünen haben eine vernichtende Bilanz über den Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD gezogen.
Parteichef Felix Banaszak (35) nannte den Auftritt der Parteispitzen der geplanten schwarz-roten Koalition peinlich. "Dieser Klamauk, den wir da gerade gesehen haben, der wird der Lage nicht gerecht."
Deutschland und die Welt stehen nach den Worten Banaszaks vor drei großen Problemen: der Umwelt- und Klimakrise, der Erosion der regelbasierten Ordnung auf der Welt und das globale Erstarken des Rechtsextremismus. Auf keine dieser Krisen hätten die möglichen Koalitionäre "auch nur den Hauch einer Antwort".
9. April, 17.18 Uhr: FDP-Politiker Dürr bescheinigt Union und SPD "Mutlosigkeit"
Der FDP-Politiker Christian Dürr (47) hat die Pläne von Union und SPD für eine gemeinsame Bundesregierung kritisiert.
"Deutschland wird zukünftig von Mutlosigkeit regiert. Mit dem Koalitionsvertrag steht es schwarz auf weiß: Mit Friedrich Merz und seiner schwarz-roten Koalition bleibt der versprochene Politikwechsel aus", sagte Dürr, der Vorsitzender seiner Partei werden will, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.
9. April, 17.17 Uhr: Wagenknecht sieht Land auf dem Weg in "Merzession"
BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht (55) sieht die Koalitionsvereinbarung von Union und SPD sehr kritisch.
"Der Koalitionsvertrag gibt keine Antwort auf Wirtschaftskrise und Handelskrieg", erklärte die Bundesvorsitzende des Bündnisses Sahra Wagenknecht. "So droht ein drittes und viertes Rezessionsjahr unter Schwarz-Rot: die Merzession." Damit werde der künftige Kanzler Friedrich Merz die AfD weiter stärken. Wagenknecht forderte "vernünftige Abgeordnete" und die Basis von Union und SPD auf, den Koalitionsvertrag zu stoppen.

9. April, 17.03 Uhr: Kein Bürgergeld für neue Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine
Neue Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sollen kein Bürgergeld mehr bekommen, sondern die geringeren Leistungen für Asylbewerber.
Darauf haben sich CDU, CSU und SPD bei ihren Koalitionsverhandlungen verständigt.
9. April, 16.59 Uhr: Schwarz-rote Koalition plant keine Rückkehr zur Atomkraft
Union und SPD wollen bis auf Weiteres keine Rückkehr Deutschlands zur Nutzung von Atomenergie prüfen.
Das geht aus dem Entwurf für den Koalitionsvertrag hervor, auf den sich CDU, CSU und SPD geeinigt haben. Darin finden sich, anders als es sich zunächst angedeutet hatte, keine Regelungen zum Thema Atomausstieg.

9. April, 16.57 Uhr: Senkung der Körperschaftsteuer ab 2028 geplant
Union und SPD wollen Unternehmen steuerlich entlasten.
Dafür sollen zuerst steuerliche Abschreibungsregeln angepasst werden, danach soll die Körperschaftsteuer sinken. Das geht aus dem Koalitionsvertrag hervor, dem die drei Parteien vor Inkrafttreten noch zustimmen müssen.
9. April, 16.54 Uhr: Union und SPD planen Kaufanreize für E-Autos
Union und SPD wollen die Nachfrage nach Elektroautos wieder stärker ankurbeln.
"Wir werden die E-Mobilität mit Kaufanreizen fördern", heißt es im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD. Genauere Angaben zur Höhe und mögliche Bedingungen wurden nicht festgeschrieben.

9. April, 16.52 Uhr: Koalitionäre planen mehr neue Militärtechnik
Union und SPD wollen in einer gemeinsamen Bundesregierung den Weg zur Einführung moderner Militärtechnik freimachen.
Dazu seien auch ein vereinfachter Zugang und ein vertiefter Austausch mit Forschungseinrichtungen, dem akademischen Umfeld, Start-Ups und der Industrie notwendig, heißt es im vereinbarten Text für einen Koalitionsvertrag.
Dies gelte insbesondere für die Bereiche: Satellitensysteme, Künstliche Intelligenz, unbemannte, auch kampffähige Systeme, den sogenannten Elektronischen Kampf, Cyber, den Einsatz von Software sowie Hyperschallsysteme.
9. April, 16.50 Uhr: Koalitionsvertrag holt Deutschland laut Söder aus der Defensive
Der Koalitionsvertrag von CSU, CDU und SPD holt Deutschland nach den Worten von CSU-Chef Markus Söder (58) außenpolitisch aus der Defensive.
Der Vertrag sei auch ein "Signal an das Ausland, Deutschland ist nicht wehrlos, wir nehmen unser Schicksal selbst in die Hand", sagte der bayerische Ministerpräsident nach der Einigung von Union und SPD in Berlin. Zugleich sei der Koalitionsvertrag auch ein Zeichen an die Bevölkerung, "wir kümmern uns um euch".
9. April, 15.51 Uhr: Regierung soll Anfang Mai an die Arbeit gehen
Der CDU-Chef und wahrscheinlich künftige Bundeskanzler Friedrich Merz (69) geht davon aus, dass die neue Bundesregierung Anfang Mai stehen wird.
Er erwarte eine Zustimmung von CDU, CSU und SPD zum Koalitionsvertrag "und dass wir dann Anfang Mai mit einer neuen Bundesregierung an die Arbeit gehen können", sagte er nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen.
Er erwarte, "dass es unserem Land dann auch bald wirklich besser geht und wir Zuversicht, Mut und auch wieder ein bisschen mehr Zukunft in diesem Land gemeinsam erarbeiten".

9. April, 15.29 Uhr: So sehen die Eckpunkte des Koalitionsvertrags aus
Bei einer Pressekonferenz im Paul-Löbe-Haus haben Union und SPD die wichtigsten Eckpunkte des Koalitionsvertrags vorgestellt.
Sie lauten:
Stopp des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte: Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus sollen zwei Jahre lang keine Familienangehörigen mehr nach Deutschland holen dürfen. Dies soll nur noch in Härtefallen erlaubt sein.
- Verschärfung beim Bürgergeld: Mit einer "neuen Grundsicherung für Arbeitssuchende" sollen nach dem schwarz-roten Koalitionsvertrag schärfere Sanktionen bis zum vollständigen Entzug der Leistungen greifen können.
Wegfall der beschleunigten Einbürgerung für gut Integrierte: Die von der Ampel-Regierung beschleunigte Einbürgerung nach drei Jahren für besonders gut integrierte Zuwanderer soll wieder abgeschafft werden. An der Reduzierung der Wartefrist für normale Einbürgerungen von acht auf fünf Jahre und an der Erlaubnis für den Doppelpass will man aber festhalten.
Höherer Mindestlohn: Für nächstes Jahr wird ein Mindestlohn von 15 Euro pro Stunde angepeilt. Die Entscheidung darüber bleibt jedoch bei der zuständigen Kommission von Experten, Arbeitgebern und Arbeitnehmern.
Freiwilligkeit bei Wehrdienst: Es soll ein neues und zunächst auf Freiwilligkeit basierendes Wehrdienstmodell eingeführt werden. Noch in diesem Jahr sollten dazu die Voraussetzungen für eine Wehrerfassung und Wehrüberwachung geschaffen werden.
Nationaler Sicherheitsrat: Durch die Einrichtung eines Nationalen Sicherheitsrats sollen wesentliche Fragen einer integrierten Sicherheitspolitik koordiniert und eine gemeinsame Lagebewertung vorgenommen werden.
Wieder Vorratsdatenspeicherung: Telekommunikationsanbieter sollen künftig dazu verpflichtet werden, IP-Adressen für mögliche Ermittlungen drei Monate lang zu speichern. Wegen rechtlicher Unsicherheiten war die alte Regelung zur Vorratsdatenspeicherung seit 2017 nicht mehr genutzt worden.
Höhere Pendlerpauschale: Union und SPD wollen Pendler steuerlich entlasten. Die Pendlerpauschale soll ab 2026 bereits vom ersten Kilometer an bei 38 Cent liegen.
Festgeschriebenes Rentenniveau: Das aktuelle Rentenniveau von 48 Prozent soll gesetzlich festgeschrieben werden. Diese Haltelinie beim Sicherungsniveau der gesetzlichen Rente im Verhältnis zum durchschnittlichen Lohn in Deutschland soll bis 2031 gelten.
Industriestrompreis: Rot-Schwarz plant einen Industriestrompreis zur Entlastung energieintensiver Unternehmen.

9. April, 15.02 Uhr: Deutschlandticket soll auch nach 2025 bleiben
Das Deutschlandticket für den Nahverkehr soll nach dpa-Informationen auch nach 2025 erhalten bleiben, Nutzer müssen sich aber von 2029 an auf Preiserhöhungen einstellen.
Darauf haben sich CDU, CSU und SPD in ihren Koalitionsverhandlungen verständigt, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr.

9. April, 13.53 Uhr: Minister-Liste für neue Regierung kursiert im Netz
Vor der wichtigen Pressekonferenz um 15 Uhr zur Vorstellung des Koalitionsvertrags kursiert bereits ein Liste zu den Ministerposten der neuen Regierung im Netz.
Wie die Frankfurter Rundschau aus Unionskreisen erfahren haben will, sollen die einzelnen Ämter wie folgt besetzt werden:
- Wirtschaftsminister Carsten Linnemann (47, CDU)
- Finanzminister: Lars Klingbeil (47, SPD)
- Innenminister: Alexander Dobrindt (54, CSU)
- Arbeitsministerin: Bärbel Bas (56, SPD)
- Verteidigungsminister: Boris Pistorius (65, SPD)
- Infrastrukturministerin: Ina Scharrenbach (48, CDU)
- Gesundheitsminister: Tino Sorge (50, CDU)
- Umweltminister: Andreas Jung (49, CDU)
- Außenminister: Johann Wadephul (62, CDU)
- Familienministerin: Silvia Breher (51, CDU)
- Digitalministerin: Kristina Sinemus (61, CDU)
- Justizministerin: Sonja Eichwede (37, SPD)
- Bildungsministerin: Dorothee Bär (46, CSU)
- Landwirtschaftsministerin: Michaela Kaniber (47, CSU)
- Entwicklungshilfeministerin: Svenja Schulze (56, SPD)
- Vorsitzender CDU/CSU-Bundestagsfraktion: Jens Spahn (44, CDU)
- Chef des Bundeskanzleramts: Thorsten Frei (51, CDU)

9. April, 12.07 Uhr: Union und SPD einig
Nach übereinstimmenden Medienberichten sollen sich Union und SPD auf einen Koalitionsvertrag geeinigt haben.
Dessen Ergebnisse sollen um 15 Uhr von CDU-Chef Friedrich Merz (69), CSU-Boss Markus Söder (58) und SPD-Chef Lars Klingbeil (47) vorgestellt werden.
9. April, 11.48 Uhr: Einigung über Top-Ministerien in neuer Regierung
Erste Top-Ministerien in der neuen schwarz-roten Regierung sollen vergeben sein.
Wie BILD erfahren hat, gehen drei Ministerien an die CSU, sieben an die CDU und fünf an die SPD.
So bekommt die CSU das Innenministerium, das Landwirtschafts- und Heimatressort sowie das Ministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt.
Die CDU erhält unter anderem das Außenministerium.
Die SPD kriegt unter anderem das Finanzministerium, das Verteidigungsministerium und das Justizministerium.

9. April, 8.36 Uhr: An diesem Datum soll Merz zum Kanzler gewählt werden
Bei einer Einigung mit der Union auf einen Koalitionsvertrag will die SPD ihre Mitglieder innerhalb von zehn Tagen digital darüber abstimmen lassen.
Aufseiten der CDU entscheidet ein kleiner Parteitag über den Vertrag, bei der CSU reicht ein Vorstandsbeschluss.
Als mutmaßlicher Bundeskanzler in spe hatte Friedrich Merz (69, CDU) ursprünglich das Ziel ausgegeben, bis Ostern eine Regierung zu bilden. Das ist inzwischen nicht mehr zu erreichen. Als mögliches Datum für Merz' Wahl und Vereidigung zum Kanzler steht nun der 7. Mai im Raum.

9. April, 8.12 Uhr: CDU-Arbeitnehmerflügel ruft zu Unterstützung von Merz auf
Der Chef der CDU-Arbeitnehmervereinigung (CDA), Dennis Radtke (45), ruft die Union dazu auf, Einigungen mit der SPD in der Sozialpolitik offensiv zu vertreten.
"Die CDU muss aufhören, sozialpolitische Verbesserungen als Zugeständnisse an die SPD zu sehen, wir müssen sie selbstbewusst vertreten", sagte Radtke den Zeitungen der Funke Mediengruppe.
Zugleich forderte er Zuversicht und Rückendeckung für den CDU-Vorsitzenden und voraussichtlich künftigen Kanzler Friedrich Merz (69, CDU). "Wir brauchen keine Untergangsstimmung, sondern Geschlossenheit und Unterstützung für unseren Vorsitzenden", sagte der CDA-Chef. "Dass ausgerechnet die in der Union, die Friedrich Merz geradezu messianische Fähigkeiten zugesprochen haben, nun enttäuscht sind, dass er nicht über das Wasser gehen kann, aber stattdessen beherzt Realpolitik betreibt, finde ich fatal", sagte Radtke.

1. April, 22.20 Uhr: Union und SPD verhandeln am Mittwoch weiter
Union und SPD setzen ihre Koalitionsverhandlungen nach Beratungen in kleineren Runden fort.
An diesem Mittwoch soll wieder die Hauptverhandlungsgruppe zusammenkommen, wie es am Abend aus Verhandlungskreisen hieß. Ihr gehören 19 führende Vertreter der drei Parteien um CDU-Chef Friedrich Merz (69), CSU-Chef Markus Söder (58) sowie die SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil (47) und Saskia Esken (63) an. Die Verhandler treffen sich in der bayerischen Landesvertretung in Berlin.
1. April, 18.14 Uhr: Bundestag überprüft Warburg-Spenden an die SPD
Parteispenden der Warburg Bank an die SPD werden jetzt vom Bundestag auf ihre Rechtmäßigkeit geprüft.
Der Abschlussbericht des Hamburger Cum-Ex-Untersuchungsausschusses werde "daraufhin ausgewertet, ob es Hinweise auf möglicherweise unzulässige Spendenzahlungen an die SPD gibt", teilte die Bundestagsverwaltung der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Zuvor hatte das Nachrichtenportal "t-online" über den Vorgang berichtet.
1. April, 16.09 Uhr: Union und SPD verhandeln zunächst in Kleingruppen
Vertreter von Union und SPD verhandeln heute zunächst in kleinen Gruppen weiter über die Bildung einer gemeinsamen Koalition.
Mehrere Spitzenpolitiker kamen dafür in der CDU-Zentrale in Berlin, dem Konrad-Adenauer-Haus, zusammen. Die Untergruppen sollen Fragen unter anderem beim Thema Finanzen klären.
1. April, 16.05 Uhr: AfD in Umfrage nur knapp hinter Union
Gut fünf Wochen nach der Bundestagswahl ist die AfD in einer Umfrage auf nur einen Punkt an die Union herangerückt.
Dem Trendbarometer von RTL und ntv zufolge haben CDU und CSU seit der Wahl deutlich eingebüßt und kommen aktuell nur noch auf 25 Prozent, die AfD kann dagegen auf 24 Prozent zulegen, ein Höchstwert für die Partei in der Forsa-Umfrage, wie es bei RTL und ntv heißt.
Die Union hatte die Wahl am 23. Februar mit 28,5 Prozent der Zweitstimmen gewonnen. Die AfD landete mit 20,8 auf Platz zwei.

31. März, 17.38 Uhr: Union und SPD setzen Koalitionsverhandlungen fort
Spitzenvertreter von Union und SPD haben in Berlin ihre Gespräche zur Bildung einer möglichen neuen Regierungskoalition fortgesetzt.
Die Chefverhandler beider Seiten kamen in der CDU-Zentrale, dem Konrad-Adenauer-Haus, zusammen.
31. März, 17.13 Uhr: Söder spricht von "Woche der Wahrheit"
CSU-Chef Markus Söder (58) setzt darauf, dass Union und SPD bei ihren Koalitionsverhandlungen in den kommenden Tagen die zentralen - insbesondere finanziellen - Streitfragen aus dem Weg räumen.
In dieser Woche werde es richtig ernst, sagte Söder vor der Fortsetzung der Gespräche in Berlin. "In dieser Woche müssen wir die großen Durchbrüche erzielen, insbesondere was die Finanzstruktur betrifft", betonte er. "Jetzt kommt die Woche der Wahrheit, würde ich sagen, in der wir die grundlegenden Weichen stellen müssen."

30. März, 21.35 Uhr: Fortführung der Koalitionsverhandlungen am Montagabend
CDU, CSU und SPD setzen am Montagabend ihre Koalitionsverhandlungen fort.
Die Hauptverhandler treffen sich in der CDU-Zentrale in Berlin. Zuvor sollten laut CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt (54) noch kleinere Runden zur "Problemlösung" zusammenkommen.
Als größte Knackpunkte gelten die Bundesfinanzen, die Steuer- und Wirtschaftspolitik sowie Wege zur Eindämmung der illegalen Migration. Am Freitag und Samstag hatte die 19-köpfige Verhandlungsgruppe in der SPD-Zentrale beraten, am Sonntag gab es eine Pause.

30. März, 15.29 Uhr: Wirtschaftsverbände mit Appell an Union und SPD
Mitten in den Koalitionsverhandlungen versucht eine Allianz von Wirtschaftsverbänden den Druck auf Union und SPD für grundlegende Reformen zu erhöhen.
In einem Brief zahlreicher Verbände an die Parteispitzen von CDU, CSU und SPD heißt es, bisherige Nachrichten aus den Koalitionsverhandlungen ließen befürchten, dass Betriebe ihre Investitionen wie zuletzt ins Ausland verlagerten oder ganz aufhörten und Investoren um Deutschland einen Bogen machten. "Alles, was Wachstum behindert, muss unterlassen werden. Das Tariftreuegesetz, ein Mindestlohn von 15 Euro oder die Mütterrente sind vor diesem Hintergrund abzulehnen."
Das Schreiben lag der Deutschen Presse-Agentur vor. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

30. März, 13.46 Uhr: Koalitionsverhandlungen auf der Zielgeraden
Bei den Koalitionsverhandlungen biegen CDU, CSU und SPD auf die Zielgerade ein - und die kann noch anstrengend werden.
Am Montag setzen die Hauptverhandler ihre Gespräche fort. Am Montagabend soll die Spitzenrunde erneut zusammenkommen, dieses Mal in der CDU-Zentrale. Dobrindt sagte, bevor die große Runde am Montagabend zusammenkomme, gebe es noch kleinere Runden, die als "Problemlösungsrunden" eingesetzt worden seien.
Zu den größten Knackpunkten zählen die Finanzen. Im Bundeshaushalt 2025 sowie der Finanzplanung der kommenden Jahre klaffen ohnehin bereits Milliardenlöcher - obwohl die Lockerung der Spielräume bei der Verteidigung neue Spielräume eröffnet. Bei dem 50 Milliarden-Euro-Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz soll es sich um zusätzliche Investitionen handeln.
30. März, 7.18 Uhr: Grünen-Fraktionschefin sieht "Russland-Connection" in CDU
Die Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann (63) hat Äußerungen des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (49, CDU) zu Lockerungen der Russland-Sanktionen scharf kritisiert.
"Während Putin weiter Bomben auf die Ukraine wirft, biedert sich Ministerpräsident Kretschmer dem Kriegstreiber wieder an", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz (69) forderte Haßelmann auf, "die Moskau-Connection in seiner Partei schnellstens abzuwickeln".
Der stellvertretende CDU-Chef Michael Kretschmer hatte das kategorische Nein Deutschlands und anderer europäischer Länder zu einer Lockerung der Sanktionen gegen Russland in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur kritisiert. "Das ist völlig aus der Zeit gefallen und passt ja auch gar nicht zu dem, was die Amerikaner gerade machen", sagte er. "Wenn man merkt, dass man sich selber mehr schwächt als das Gegenüber, dann muss man darüber nachdenken, ob das alles so richtig ist."
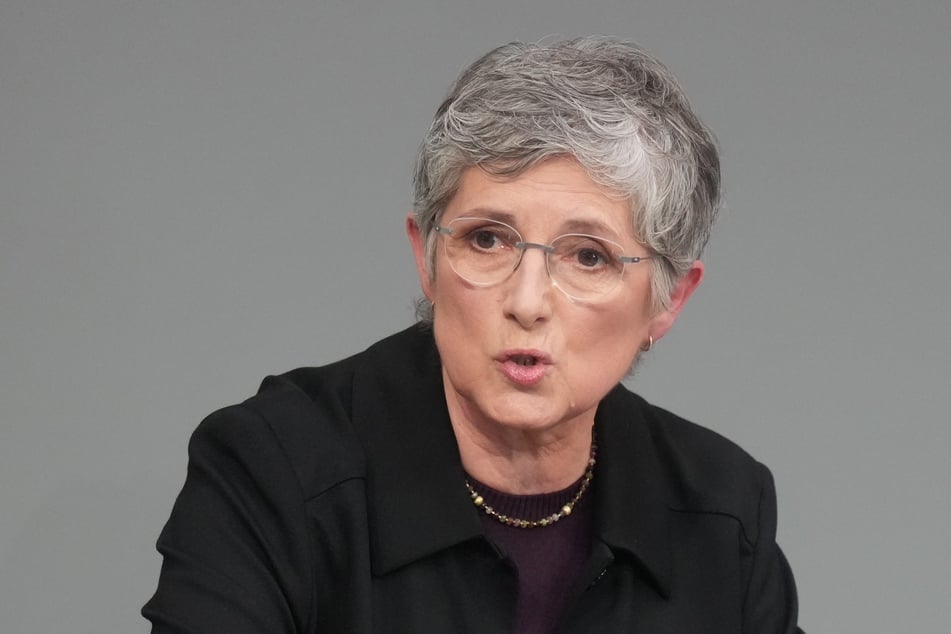
29. März, 19.30 Uhr: Koalitionsverhandler beraten knapp fünf Stunden
Die Hauptverhandler von CDU, CSU und SPD haben knapp fünf Stunden lang in der SPD-Zentrale in Berlin über die Bildung einer schwarz-roten Koalition gesprochen.
Am Montagabend sollen die Beratungen der Spitzengruppe weitergehen, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt (54) nach dem Ende des Treffens am Samstagnachmittag beim Verlassen des Willy-Brandt-Hauses.
Vor den weiteren Gesprächen der Hauptverhandler gebe es auch noch kleinere Runden zur Problemlösung, sagte der 54-Jährige. Zu den Inhalten der Gespräche vom Samstag machte er hingegen keine Angaben. "Wir sind vorangekommen", erklärte Dobrindt lediglich. Man arbeite sich näher an das Ziel heran.

29. März, 12.48 Uhr: Grünen-Fraktionsspitze - "Das grüne Wirtschaftswunder geht erst los"
Die Fraktionsspitze der Grünen im Bundestag sieht mehr Klimaschutz als wesentlichen Treiber bei der wirtschaftlichen Entwicklung.
"Das grüne Wirtschaftswunder geht erst los", sagte die Co-Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann (63) dem "Handelsblatt" in einem Doppel-Interview mit der Co-Fraktionsvorsitzenden Katharina Dröge (40). "Ohne Klimaschutz, ohne Transformation kann es auch keinen Wohlstand mehr geben. Ideen der CDU wie das Zurückdrehen des Verbots von Verbrenner-Autos ab 2035 werden der Wirtschaft nicht helfen, sondern nur Unsicherheit schüren und uns im internationalen Wettbewerb zurückwerfen."

29. März, 10.29 Uhr: Union und SPD setzen Beratungen fort - Finanzen im Zentrum
CDU, CSU und SPD setzen ihre Beratungen über eine neue schwarz-rote Koalition fort. Spitzenverhandler kamen am Vormittag - wie schon am Vortag - in der SPD-Zentrale in Berlin zusammen.
Erneut sollte es um den Schwerpunkt Finanzen gehen. Die stellvertretende CDU-Vorsitzende und schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien (59) zeigte sich beim Eintreffen optimistisch: "Wir kommen zu guten Lösungen", sagte sie.
CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt (54) sagte auf die Frage, ob die Runde bis Ostern mit den Verhandlungen durch sei, es sei "eine ganze Menge Arbeit, die ansteht. Aber wir haben einen ambitionierten Zeitplan". Er sei "guter Dinge, dass wir schnell vorankommen können". Die Beratungen liefen ausgesprochen gut, es gebe viel Verständnis für die gemeinsame Lage.
29. März, 8.47 Uhr: Mehrheit der Bürger gegen Änderung bei Wahlrecht
Die Bürger in Deutschland sind die ständigen Änderungen am Bundestags-Wahlrecht offenbar leid. In einer YouGov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sprach sich 47 Prozent der Befragten dafür aus, das aktuelle Wahlrecht beizubehalten. Nur 34 Prozent befürworteten eine erneute Reform. 18 Prozent hatten dazu keine Meinung.
Zuletzt war das Wahlrecht 2023 von den Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP geändert worden. Durch die Reform wurde die Größe des Bundestages auf 630 Mandate gedeckelt. Bei der Bundestagswahl 2021 waren noch 735 Abgeordnete ins Parlament eingezogen. Erreicht wurde dies durch den Verzicht auf Überhang- und Ausgleichsmandate.
Dazu erhalten einige Wahlkreisgewinner kein Direktmandat mehr, wenn ihren Parteien die nötige Zweitstimmendeckung fehlt. Bei der Wahl im Februar hatte dies zur Folge, dass 23 Gewinner eines Wahlkreises nicht in den Bundestag einzogen.
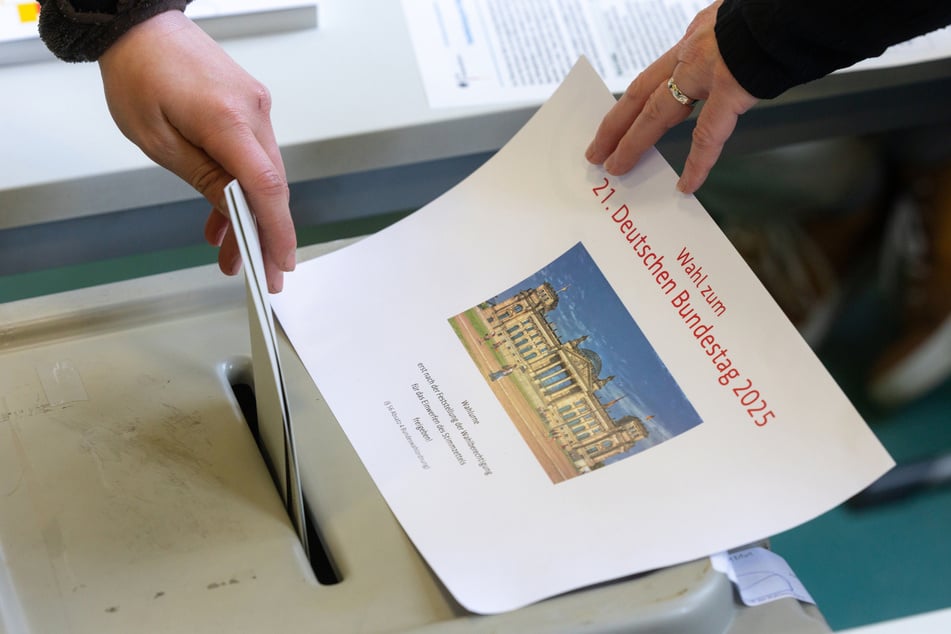
29. März, 8.43 Uhr: Mehrheit befürwortet mehr Befugnisse für Sicherheitsbehörden
Viele Deutsche halten mehr Befugnisse der Sicherheitsbehörden zur Kriminalitätsbekämpfung und Verhinderung von Terroranschlägen für sinnvoll.
Mit Blick auf die laufenden Koalitionsverhandlungen von Union und SPD, bei denen es auch darum geht, was Polizei und Verfassungsschutz künftig in ihrem Werkzeugkasten haben sollen, sind laut einer Umfrage 62 Prozent der Bürgerinnen und Bürger der Ansicht, die Sicherheitsbehörden sollten mehr Befugnisse erhalten.
Wie die Ergebnisse der repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur zeigen, halten 22 Prozent der Wahlberechtigten die aktuellen Befugnisse von Polizei und Inlandsnachrichtendienst hingegen für ausreichend. Lediglich vier Prozent der 2.144 Teilnehmer der Umfrage sprachen sich dafür aus, ihre Befugnisse einzuschränken.
29. März, 8.40 Uhr: Miersch zu Koalitionsgesprächen - "Nichts in Stein gemeißelt"
SPD-Generalsekretär Matthias Miersch (56) warnt bei den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD vor pauschalen Kürzungen in allen Ressorts.
"Die pauschale Rasenmäher-Methode, bei der ressortübergreifend zehn bis 15 Prozent gekürzt wird, klingt einfach, kann jedoch fatale Folgen haben", sagte Miersch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
Er nannte als Beispiele den Zoll oder die Steuerfahndung. "Wir brauchen mehr Kontrolle, denn durch Steuerhinterziehung entgehen dem Staat rund 100 Milliarden jährlich. Darüber redet die Union aber nicht so gern", sagte Miersch.
28. März, 15.56 Uhr: Sachsens MP knallhart - "Land ist wirtschaftlich am Ende"
Der stellvertretende CDU-Chef Michael Kretschmer (49) erwartet von einer neuen schwarz-roten Regierung, dass sie als Startsignal ein 100-Tage-Sofortprogramm mit konkreten Maßnahmen vorlegt.
"Es muss schnell erkennbar werden, dass jetzt Dinge sich hier verändern", sagte der sächsische Ministerpräsident, der im Kernteam der Koalitionsverhandlungen mit der SPD sitzt, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.
"Dieses Land ist aufgewühlt, ist wirtschaftlich am Ende", kritisierte Kretschmer. "Wir haben Rezession. Wir haben einen Haushalt, der in einer wirklich aktuellen Notlage ist." In den Verhandlungen brauche es das Verständnis: "Wie kann das innerhalb von ein, zwei Jahren gedreht werden?" Es müssten wirtschaftliche Dynamik und zusätzliche Steuereinnahmen erzeugt werden und man müsse das Vertrauen in Demokratie und Rechtsstaat zurückgewinnen.
Zudem müssten "klare neue politische Ansätze zum Thema Migration" in dem 100-Tage-Programm stehen. Bei dem Thema sei Deutschland in den vergangenen Jahren "der Falschfahrer" gewesen, sagte Kretschmer. "Wir haben Europa aufgehalten bei einer konsequenten Flüchtlingspolitik, bei einem konsequenten Außengrenzenschutz."

28. März, 9.39 Uhr: Söder lehnt Steuererhöhungen strikt ab
CSU-Chef Markus Söder (58) lehnt Steuererhöhungen durch die geplante Koalition aus Union und SPD strikt ab.
Sozialdemokraten mögen diese gern, sagte der bayerische Ministerpräsident im ARD-"Morgenmagazin". "Das werden wir nicht tun. Wir brauchen Steuersenkungen", betonte er vor Verhandlungen der Spitzen von Union und SPD am Nachmittag. Zugleich müsse gespart werden. Wo dies geschehen soll, sei einer der schwierigsten Bereiche in den Verhandlungen.

28. März, 6.07 Uhr: Grüne kritisieren erwogene Vorhaben von Union und SPD
Die Grünen kritisieren zahlreiche erwogene Vorhaben der potenziellen Koalitionspartner Union und SPD, darunter solche zur Eindämmung der Migration und zur Sanktionierung von Bürgergeld-Empfängern.
Der Grünen-Innenexperte Konstantin von Notz (54) bezog sich unter anderem auf die abermalige befristete Aussetzung des Familiennachzugs zu Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutz, wie es die zuständige Arbeitsgruppe von Union und SPD vorgeschlagen hat. "Das schafft großes Leid und erschwert Integration massiv: Wer ständig Angst um seine Kinder oder Ehepartner haben muss, hat weniger Kraft, hier in Deutschland anzukommen. Kinder würden jahrelang von einem Elternteil oder den Geschwistern getrennt leben müssen", sagte von Notz der "Rheinischen Post".

28. März, 6 Uhr: SPD-Generalsekretär fordert Koalition auf Augenhöhe
Vor Beginn der Hauptverhandlungsrunde für eine schwarz-rote Koalition am Freitag hat SPD-Generalsekretär Matthias Miersch (56) den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz (69) zu einem respektvollen Umgang mit den Sozialdemokraten aufgerufen.
"Es muss auf alle Fälle eine Koalition auf Augenhöhe geben. Man braucht Empathie auch für die Koalitionspartner", sagte Miersch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland auf die Frage nach seinen Erwartungen an die Führungsstärke des möglichen nächsten Bundeskanzlers.

27. März, 18.45 Uhr: Bafög-Erhöhung im nächsten Jahr im Gespräch
Union und SPD diskutieren in ihren Koalitionsverhandlungen über eine Bafög-Erhöhung im nächsten Jahr.
Das geht aus einem in Berlin kursierenden Papier der Koalitionsarbeitsgruppe Bildung, Forschung und Innovation hervor. Erwogen wird demnach eine Anhebung der im Bafög enthaltenen Wohnkostenpauschale für Studierende, die nicht mehr bei den Eltern wohnen, von derzeit 380 auf 440 Euro im Monat zum Wintersemester 2026/27.
Ob und in welcher Form der Vorschlag in einen endgültigen Koalitionsvertrag von Union und SPD einfließt, ist offen. Darüber beraten die Chefverhandler der Parteien ab Freitag in der nächsten Runde der Koalitionsgespräche. Die Vorschläge der Arbeitsgruppen stehen generell unter Finanzierungsvorbehalt.

27. März, 14 Uhr: Koalitions-Unterhändler wollen Verschärfungen bei Migration
Unterhändler von CDU/CSU und SPD planen Verschärfungen der Migrationspolitik.
Nach einem kursierenden Entwurf der AG Innen, Recht, Migration und Integration wollen sie unter anderem die Reihe sicherer Herkunftsstaaten ausweiten, in die Menschen leichter abgeschoben werden können. "Wir beginnen mit der Einstufung von Algerien, Indien, Marokko und Tunesien." Eine Erweiterung soll ständig geprüft werden, heißt es in dem Papier, an dem es noch Änderungen im Detail gegeben haben könnte.

26. März, 18.02 Uhr: Festhalten am Kohleausstieg bis 2038
Die Unterhändler von CDU/CSU und SPD wollen am Kohleausstieg spätestens 2038 festhalten.
Differenzen gibt es bei der künftigen Rolle der Atomkraft. Ihr schreibt nur die Union eine möglicherweise "bedeutende Rolle" zu. Sie will auch prüfen, ob die zuletzt abgeschalteten Kernkraftwerke wieder in Betrieb gehen könnten.
Die Belastungen durch den steigenden CO2-Preis, der Tanken und Heizen teurer macht, wollen die Verhandler ausgleichen. "Die CO2-Einnahmen geben wir an die Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen zurück", heißt es in dem Papier.

26. März, 15.41 Uhr: Unterhändler von Union und SPD für CO2-Speicherung
Überlegungen innerhalb der werdenden schwarz-roten Koalition zur künftigen Klimapolitik lösen Kritik aus.
Grünen-Politiker und Umweltverbände fürchten nach Bekanntwerden eines Entwurfs der Arbeitsgruppe Klima und Energie Abschwächungen beim Klimaschutz. Dabei geht es insbesondere um Passagen zum Umgang mit Treibhausgasen.
"Die Klimaziele erreichen wir vorrangig durch Reduktion von CO2, zusätzlich durch Anrechnung negativer Emissionen", heißt es in dem Papier - also durch Einsparungen von Kohlendioxid (CO2) und dessen Entnahme aus der Atmosphäre. Die Unterhändler von CDU und CSU wollen weitergehen: Sie wollen dabei auch auf "glaubwürdige CO2-Reduzierung in Partnerländern" setzen. Die Umweltorganisation Germanwatch kritisierte: "Eine Abwälzung der eigenen Verantwortung auf andere Staaten wäre ungerecht."

26. März, 14.51 Uhr: Weidel lädt Klöckner erneut in AfD-Fraktion ein
Die AfD im Bundestag hat die neu gewählte Parlamentspräsidentin Julia Klöckner (52) in eine ihrer nächsten Fraktionssitzungen eingeladen.
"Unsere Einladung zu einem Austausch in unserer Fraktion steht. Wir freuen uns, wenn Frau Klöckner es einrichten kann, in eine unserer nächsten Sitzungen zu kommen", sagte Partei- und Fraktionschefin Alice Weidel (46) dem "Tagesspiegel". "Das Thema des Umgangs mit der AfD als zweitstärkste Kraft im Deutschen Bundestag ist aus unserer Sicht ein dringendes", fügte sie hinzu.
26. März, 12.58 Uhr: Wüst enttäuscht über Wahlergebnis seiner Union
Knapp einen Monat nach der Bundestagswahl hat sich NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (49, CDU) enttäuscht über das Abschneiden seiner Partei gezeigt.
"Wir können als Union insgesamt mit dem Wahlergebnis nicht zufrieden sein. Wir haben uns mehr vorgenommen", sagte er am Dienstagabend in der ARD-Sendung "Maischberger".
CDU und CSU wurden bei der Wahl im Februar mit insgesamt 28,5 Prozent der Zweitstimmen stärkste Kraft. Dass die Ampel-Parteien im Vergleich zu 2021 fast 20 Prozentpunkte verloren hätten, die Union aber nur knapp vier Prozentpunkte dazu gewann, "dann ist das kein gutes Ergebnis", sagte er. "Friedrich Merz hat selber von 35 Prozent und mehr gesprochen, was drin sein sollte."
26. März, 12.55 Uhr: Beauftragter fordert Teil des 500-Milliarden-Topfs für Erinnerung
Von den geplanten 500 Milliarden Euro für Infrastruktur sollte aus Sicht des Antiziganismusbeauftragten auch Geld in die Erinnerung an die Verbrechen der Nationalsozialisten fließen.
"Gedenkstätten wie Buchenwald oder Auschwitz sind als Teil der demokratischen Infrastruktur zu verstehen", erklärte der Bundesbeauftragte Mehmet Daimagüler in Berlin. Er bezog sich darauf, dass Gelder aus dem gerade vereinbarten schuldenfinanzierten Sondervermögen ausdrücklich auch für Bildung gedacht seien.

26. März, 11.38 Uhr: Kritik von Grünen an Plänen zum Deutschlandticket
Von den Grünen kommt Kritik an Plänen von Unterhändlern von Union und SPD zum Deutschlandticket.
"Wenn das Deutschlandticket teurer wird, dann wird der Weg zur Arbeit mit dem ÖPNV teurer und das Auto wieder attraktiver", sagte die Grünen-Haushälterin Paula Piechotta (38) der Deutschen Presse-Agentur. "In der Folge werden wir wieder mehr Stau, mehr CO2-Ausstoß und ungesündere Luftwerte in den Städten sehen." Bei Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (69) und SPD-Chef Lars Klingbeil (47) seien Klimaschutz und Verkehrswende verloren. "Es werden bittere vier Jahre für alle, die lieber Bahn, Bus oder Rad fahren statt Auto."
26. März, 11.35 Uhr: Laut Klöckner steht es Abgeordneten frei, AfD-Kandidaten abzulehnen
Die neue Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (52) hat das Parlament für seine Entscheidung verteidigt, den AfD-Kandidaten für das Amt ihres Stellvertreters abzulehnen.
"Wenn man Mehrheitsentscheidungen eines Parlaments zum Beispiel als Kartell abtut, dann hat man die Demokratie nicht verstanden und da schreite ich zum Beispiel auch ein", sagte die CDU-Politikerin dem Deutschlandfunk. Von einem "Kartell" der anderen Parteien gegen ihren Kandidaten für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten hatte etwa der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Bernd Baumann, gesprochen.
26. März, 8.53 Uhr: AfD rückt bei Umfrage-Knaller gefährlich nahe an Union
Gut einen Monat nach der Bundestagswahl liegt die AfD einer YouGov-Umfrage zufolge nur noch knapp hinter der Union.
CDU und CSU kommen in der Sonntagsfrage auf 26 Prozent, die AfD auf 24 Prozent. Bei der Bundestagswahl am 23. Februar hatte die Union noch 28,5 Prozent der Zweitstimmen geholt, die AfD als zweitstärkste Kraft auf 20,8 Prozent erreicht.
Die SPD kommt in der Umfrage auf 15 Prozent, etwas weniger als die 16,4 Prozent vom Wahltag. Die Grünen können mit 12 Prozent können etwa ihr Wahlergebnis (11,6) halten. Die Linke legt hingegen nochmals auf 10 Prozent zu (8,8 Prozent). Das Bündnis Sahra Wagenknecht, das hauchdünn den Einzug ins Parlament verpasst hatte, kommt bei YouGov auf 5 Prozent. Die FDP landet bei 3 Prozent. Auch sie hatte mit 4,3 Prozent die Wiederwahl in den Bundestag verfehlt.

26. März, 8.41 Uhr: Koalitions-Arbeitsgruppe für besseren Mieterschutz
Unterhändler von Union und SPD wollen Mieter effektiver vor überhöhten Mieten schützen.
In einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Papier der Arbeitsgruppe Verkehr und Infrastruktur, Bauen und Wohnen heißt es nicht nur, die Mietpreisbremse solle für zunächst zwei Jahre verlängert werden. Eine Expertengruppe soll bis Ende 2026 auch ein Bußgeld für Vermieter vorbereiten, die sich nicht an diese Vorschrift halten. Die Mietpreisbremse begrenzt in Regionen mit angespanntem Wohnungsmarkt die Mieten in neuen Verträgen.

26. März, 8.38 Uhr: Parlament bildet Gesellschaft laut Klöckner nicht ganz ab
Die neue Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (52) räumt ein, dass sich die Gesellschaft in ihrer Breite nicht komplett im neugewählten Parlament widerspiegelt.
"Die Gesellschaft ist in ihrer Vielfalt nicht gänzlich abgebildet", sagte die CDU-Politikerin in den ARD-"Tagesthemen". "Und dass wir so wenig Frauen haben, das ist nicht nur bedauerlich – ich halte das auch für einen Nachteil bei der Gestaltung von Politik", fügte Klöckner hinzu. Frauen machen weniger als ein Drittel der 630 Abgeordneten aus. Das ist nochmals etwas weniger als in der vorherigen Legislaturperiode.
26. März, 8.34 Uhr: Koalitions-Arbeitsgruppe will Reformen bei Bahn und Autobahn
Unterhändler von CDU, CSU und SPD schlagen Reformen bei der Deutschen Bahn und der Autobahn GmbH vor.
Mittelfristig solle es eine grundlegende Bahnreform geben, geht aus dem Papier der Arbeitsgruppe Verkehr und Infrastruktur, Bauen und Wohnen hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Weiter heißt es, sowohl beim Bahn-Konzern als auch bei der Infrastruktursparte InfraGO solle eine "Neuaufstellung von Aufsichtsrat und Vorstand" erfolgen mit dem Ziel, mehr Fachkompetenz abzubilden und eine Verschlankung zu erreichen.
26. März, 8.32 Uhr: Bundestagspräsidium - AfD erwägt Aufstellung weiterer Kandidaten
Die AfD-Fraktion könnte nach dem Scheitern von Gerold Otten (69) weitere Kandidaten für das Amt eines Vizepräsidenten des neuen Bundestags aufstellen.
"Ich gehe davon aus, dass wir das machen werden", sagte der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Bundestag, Tino Chrupalla (49), auf die Frage, ob es weitere Kandidaten geben wird. Die Partei werde nun darüber beraten.
25. März, 18.01 Uhr: Steinmeier überreicht Scholz-Regierung Entlassungsurkunden
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69, SPD) hat die scheidende Regierung um Kanzler Olaf Scholz (66, SPD) für ihr Krisenmanagement gewürdigt.
Vor der Aushändigung der Entlassungsurkunden an Scholz und seine 14 Minister erinnerte Steinmeier im Schloss Bellevue an die Corona-Pandemie, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, den Angriff der Hamas auf Israel und den anschließenden Gaza-Krieg. "Sie als Bundesregierung mussten sehr oft sehr schnell und entschlossen handeln", sagte der Bundespräsident. "Sie mussten unbekanntes Terrain begehen und neue Wege suchen."

25. März, 17.16 Uhr: Merz will keine Verhandlungen über Ampel 2.0
Unionsfraktionschef Friedrich Merz (69, CDU) fordert vor der nächsten Phase der Koalitionsverhandlungen von der SPD die Bereitschaft zum Politikwechsel in den Bereichen Migration, Wirtschaft, Staatsfinanzen sowie Energie- und Umweltpolitik.
Dies sei der Auftrag, dem sich die Verhandler jetzt stellen müssten, sagte der wohl künftige Kanzler am Rande der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestags dem Fernsehsender "Phoenix". "Ich habe den sicheren Eindruck, dass auch die Sozialdemokraten das verstanden haben", fügte der CDU-Vorsitzende hinzu.
"Es wird hier nicht die Ampel 2.0 verhandelt, sondern es wird eine neue Bundesregierung unter der Führung der Union verhandelt", sagte Merz. "Die SPD weiß, dass sie sich in vielen Bereichen hier bewegen muss."

25. März, 16.05 Uhr: Bundestag wählt vier Vizepräsidenten - AfD-Mann fällt durch
Nach der Wahl der CDU-Politikerin Julia Klöckner (52) hat der neue Bundestag in seiner ersten Sitzung auch vier Stellvertreter bestimmt.
In das Präsidium des Parlaments gewählt wurden Andrea Lindholz (54, CSU), Josephine Ortleb (38, SPD), Omid Nouripour (49, Grüne) und Bodo Ramelow (69, Linke). Der AfD-Kandidat Gerold Otten (69) erhielt nicht die nötige Stimmenzahl und scheiterte.

25. März, 15.23 Uhr. Söders Wunschkandidat will nicht Bundesagrarminister werden
Der Wunschkandidat von CSU-Chef Markus Söder (58) für das Amt des Bundesagrarministers gibt auf: Bayerns Bauernpräsident Günther Felßner (58) zieht sich aus dem Rennen zurück.
Das teilte der CSU-Politiker Felßner überraschend in einer persönlichen Erklärung in München mit. Vorausgegangen waren breite Proteste von Umwelt- und Tierschützern gegen Felßners mögliche Kür, die am Montag in einer Aktion auf Felßners Hof gipfelten: Aktivisten der Organisation "Animal Rebellion" protestierten direkt auf dem Gelände – die Polizei ermittelt nach Angaben eines Sprechers wegen Verdachts auf Hausfriedensbruch.

25. März, 14.53 Uhr: Klöckner fordert "Optimismus-Ruck" in Deutschland
Die neue Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (52, CDU) fordert konsequente Reformen und mehr Optimismus in Deutschland.
Das Land kämpfe um seine internationale Wettbewerbsfähigkeit und damit um Wachstum, Wohlstand, Arbeitsplätze und Nachhaltigkeit, sagte die CDU-Politikerin in der ersten Rede nach ihrer Wahl ins protokollarisch zweithöchste Staatsamt nach dem Bundespräsidenten. "Die Bürgerinnen und Bürger, die erwarten von uns, dass wir ihre Probleme und Sorgen angehen. Sie wollen konsequente Reformen, auch in der Politik selbst."
25. März, 13.38 Uhr: CDU-Politikerin Julia Klöckner zur Präsidentin gewählt
Die CDU-Politikerin Julia Klöckner (52) ist neue Bundestagspräsidentin.
In der konstituierenden Sitzung des Parlaments wählten die Abgeordneten die 52-Jährige mit großer Mehrheit in das zweithöchste Staatsamt. Auf die frühere Bundeslandwirtschaftsministerin entfielen 382 Ja- und 204 Nein-Stimmen, es gab 31 Enthaltungen und 5 ungültige Stimmen.

25. März, 12.32 Uhr: Gysi-Kritik an israelischer Regierung - Zweistaatenlösung
Der Linke-Politiker Gregor Gysi (77) hat seine Kolleginnen und Kollegen als Alterspräsident des neuen Bundestages aufgefordert, sich im Nahostkonflikt verstärkt für eine Zweistaatenlösung einzusetzen.
Deutschland habe wegen seiner Geschichte und der in der Nazizeit getöteten sechs Millionen Jüdinnen und Juden eine besondere Verantwortung für einen souveränen, unabhängigen und sicheren jüdischen Staat, sagte Gysi in Berlin bei der Eröffnung der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestages. Aber auch die Palästinenserinnen und Palästinenser hätten ein Recht auf ein Zuhause, auch ihnen gegenüber habe Deutschland besondere Verantwortung.
25. März, 12.28 Uhr: Bundeskanzler soll sich laut Gysi beim Osten entschuldigen
Der Linken-Politiker Gregor Gysi (77) hat in seiner Rede als Bundestags-Alterspräsident den künftigen Bundeskanzler aufgefordert, sich bei den Ostdeutschen für Fehler bei der Deutschen Einheit zu entschuldigen.
"Das gäbe einen wirklichen Ruck bei der Herstellung der inneren Einheit", sagte Gysi bei der konstituierenden Sitzung des Bundestags.

25. März, 12.20 Uhr: Gysi schlägt neue Beratungsgremien vor
Der Alterspräsident des neuen Bundestags, Gregor Gysi (77), hat sich für die Einrichtung "überparteilicher Gremien" beim Parlament ausgesprochen, um Lösungsvorschläge für wichtige Politikfelder zu erarbeiten.
Dort könnten offen, ehrlich und ohne Öffentlichkeit bestimmte Fragen erörtert werden, sagte der Linke-Politiker in seiner Ansprache zur Eröffnung der Wahlperiode. Als Themen für solche Gremien nannte Gysi eine sichere künftige Rente, Fragen der Steuergerechtigkeit, die Finanzierung des Gesundheitswesens und eine Reform für weniger Bürokratie.
25. März, 12.03 Uhr: Alterspräsident Gysi mahnt zu gegenseitigem Respekt
Als Alterspräsident des Bundestags hat der Linken-Politiker Gregor Gysi (77) alle Abgeordnete aufgefordert, den jeweils anderen Standpunkt zu respektieren.
Zugleich appellierte Gysi an die Mitglieder des Bundestags, einfacher und bürgernäher zu sprechen. "Im Übrigen müssen wir alle ehrlicher werden", forderte der 77-Jährige.
25. März, 11.11 Uhr: Gysi eröffnet erste Sitzung - Protest von AfD
Der im Februar neu gewählte Bundestag ist zu seiner ersten Sitzung zusammengetreten.
30 Tage nach der Wahl begann damit die 21. Wahlperiode. Alterspräsident Gregor Gysi (77) eröffnete die konstituierende Sitzung. Der Linke-Politiker ist der Abgeordnete mit den meisten Jahren im Bundestag.
Die AfD-Fraktion beantragte zu Beginn der Sitzung eine Änderung der Geschäftsordnung, damit der älteste Abgeordnete Alterspräsident wird. Diese Regelung galt vor 2017. Ältester Abgeordneter ist der AfD-Ehrenvorsitzende Alexander Gauland (84). Schon bei der konstituierenden Sitzung des Bundestages 2021 hatte die AfD einen solchen Antrag gestellt und war damit gescheitert.

25. März, 11.10 Uhr: Steinmeier bereitet Entlassung der Regierung Scholz vor
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69) hat Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) gebeten, seine Amtsgeschäfte nach der für den Nachmittag geplanten Entlassung der gesamten Regierung bis zur Ernennung eines neuen Kabinetts weiterzuführen.
Das teilte das Bundespräsidialamt mit. Damit ist der erste formelle Schritt zu einem Regierungswechsel vollzogen.
Nach der Konstituierung des neuen Bundestags heute Vormittag wird Steinmeier dem Kanzler und seinen 14 verbliebenen Ministern gegen 17.30 Uhr die Entlassungsurkunden aushändigen. Das schreibt das Grundgesetz in Artikel 69 vor: "Das Amt des Bundeskanzlers oder eines Bundesministers endigt in jedem Falle mit dem Zusammentritt eines neuen Bundestages", heißt es da.
25. März, 10.56 Uhr: Koalitions-Unterhändler wollen Heizungsgesetz abschaffen
In den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD schlagen Unterhändler eine Abschaffung des Heizungsgesetzes vor.
Wie das Portal "Table Media" berichtete, einigte sich darauf die Arbeitsgruppe Verkehr und Infrastruktur, Bauen und Wohnen. Der Bericht wurde der Deutschen Presse-Agentur aus Kreisen der Arbeitsgruppe bestätigt. Das bedeutet aber keine endgültige Einigung, über das Papier beraten nun die Chefverhandler der Parteien. Generell stehen zudem Vorschläge aus den Arbeitsgruppen unter Finanzierungsvorbehalt.
25. März, 6.45 Uhr: Erste Sitzung - Linken-Politiker Gysi als Alterspräsident
Als Gregor Gysi (77) 1966 in der DDR den Abschluss als Facharbeiter für Rinderzucht machte und im Dezember 1989 zum Vorsitzenden der SED im zerfallenden zweiten deutschen Staat gewählt wurde, konnte er sich wohl kaum vorstellen, einmal als Alterspräsident des Deutschen Bundestages eine Wahlperiode zu eröffnen. Nun wird er es tun und in die Fußstapfen des inzwischen gestorbenen Wolfgang Schäuble (†81, CDU) treten.
Alterspräsident ist das Mitglied des Bundestages, das die meisten Abgeordnetenjahre vorweisen kann. Seine Aufgabe ist es, die erste Sitzung bis zur Wahl eines neuen Bundestagspräsidenten oder einer -präsidentin zu leiten. Dazu gehört es, in Abstimmung mit den Fraktionen die Schriftführer zu ernennen. Üblicherweise hält der Alterspräsident auch eine Rede.

25. März, 6.22 Uhr: Gesundheitswesen für Ernstfall vorbereiten
Die Gesundheitsversorgung in Deutschland muss aus Sicht des Grünen-Experten Janosch Dahmen umfassend für die akute Bedrohungslage durch Russland gewappnet werden.
Der Bundestagsabgeordnete sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Unser System ist auf planbare Eingriffe ausgelegt – nicht auf eine Massenanzahl an Verwundeten und schon gar nicht auf die Versorgung unter anhaltenden Drohnenangriffen oder gar Artilleriebeschuss".
Die Großmachtfantasien des russischen Präsidenten Wladimir Putin (72) ließen keinen Zweifel, dass auch Deutschland von Krieg betroffen sein könnte, machte Dahmen deutlich. "Wir müssen deshalb in der Lage sein, im Ernstfall bis zu 1000 Verletzte pro Tag in Deutschland zu versorgen. Als Notfallmediziner weiß ich: Das gelingt nur mit systematischer Vorbereitung."

24. März, 20.23 Uhr: Merz: In Koalitionsverhandlungen wächst das Vertrauen
Unionsfraktionschef Friedrich Merz ist bemüht, den Eindruck tiefer Verwerfungen bei den Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD zu zerstreuen.
"Die Atmosphäre wird beständig besser, und das Vertrauen wächst. Und dieses Vertrauen brauchen wir zueinander", wurde der voraussichtlich nächste Kanzler von Teilnehmern einer Sitzung der neuen Unionsfraktion im Bundestag mit Blick auf das persönliche Miteinander zitiert. Die Verhandlungen seien derzeit in einer völlig normalen Phase.
Aus einigen der Arbeitsgruppen gebe es ausdrücklich sehr gute Ergebnisse, sagte der CDU-Vorsitzende demnach. "An anderer Stelle müssen wir noch nacharbeiten." Man lasse sich nicht unter Zeitdruck setzen. Merz betonte: "Ich bin sehr zuversichtlich, dass uns das gut gelingt."
24. März, 12.42 Uhr: CSU nominiert Lindholz als Vizepräsidentin des Bundestages
Einen Tag vor der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestages hat die CSU mit der Innenexpertin Andrea Lindholz (54) ihre Kandidatin für das Amt einer Bundestagsvizepräsidentin nominiert.
Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen schlägt die CSU-Landesgruppe die 54-Jährige bei einer Gegenstimme für das Amt vor. Morgen soll die bisherige CDU-Schatzmeisterin Julia Klöckner (52) nach dem Willen der Union zur Bundestagspräsidentin gewählt werden. Auch die Wahl der Stellvertreterinnen und Stellvertreter steht dann an.
24. März, 12.40 Uhr: Rechnungshöfe besorgt über Giga-Schuldenpaket
Die 16 Rechnungshöfe der Länder haben große Sorgen wegen des Schuldenpakets geäußert, das von Bundestag und Bundesrat verabschiedet worden ist.
Es handele sich um die größte Neuverschuldung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der 16 Landesrechnungshöfe. "Die Finanzierung von Kernaufgaben des Staates über Schulden muss die Ausnahme bleiben", sagte der Vorsitzende der Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten, Kay Barthel, aus Sachsen-Anhalt. Laut Berechnungen des Bundesrechnungshofes entstünden durch die gigantische Neuverschuldung dauerhaft zusätzliche Zinsausgaben von zwölf Milliarden Euro pro Jahr, sagte er.

24. März, 12.36 Uhr: Union über Verhandlungen: Gründlichkeit vor Schnelligkeit
Die Union sieht nach dem Ende der Arbeitsgruppenphase in den Koalitionsverhandlungen mit der SPD noch tiefgreifende Differenzen und warnt vor unnötigem Zeitdruck.
Es gebe "sowohl beim Migrationsthema als auch bei der Innenpolitik insgesamt unterschiedliche Sichtweisen", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei (51), vor Beratungen der CDU-Spitze in Berlin.
Man könne aber durchaus zu Kompromissen kommen, ergänzte der CDU-Politiker. "Es wäre also völlig verfrüht, jetzt da etwas Konkretes zu sagen. Wir sind mitten in den Verhandlungen und die werden uns vermutlich auch noch einiges abverlangen."
24. März, 6.21 Uhr: Landeschef fordert Gleichberechtigung in der Regierung
Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (51) hat sich dafür ausgesprochen, dass im künftigen Bundeskabinett Frauen und Männer gleichberechtigt berücksichtigt werden.
Der CDU-Politiker bejahte eine entsprechende Frage in einem "Tagesspiegel"-Interview. "Frauen müssen in der CDU genauso viel Macht haben wie Männer. Wir dürfen uns nicht damit abfinden, dass der Frauenanteil in unserer Fraktion auf nur noch 22,6 Prozent gesunken ist." Über Personalfragen zu einem Kabinett unter dem wahrscheinlich nächsten Kanzler Friedrich Merz (69, CDU) wollte Günther nicht spekulieren.

22. März, 15.48 Uhr: AfD-Fraktion will Bundestagsvize
Die AfD-Fraktion wählt in einer Sitzung am Montag einen Abgeordneten aus ihren Reihen, der sich um das Amt des Bundestagsvizepräsidenten bewerben soll.
Wie ein Fraktionssprecher auf Anfrage mitteilte, haben fünf Männer zumindest Interesse an einer Kandidatur bekundet: Malte Kaufmann (48), Michael Kaufmann (60), Jochen Haug (52), Gerold Otten (69) und Karsten Hilse (60). Nach Angaben des Sprechers wollen sich die fünf Abgeordneten bis zur Sitzung verständigen, wer sich von ihnen intern zur Wahl stellt. Am Dienstag konstituiert sich der neue Bundestag.

22. März, 11.45 Uhr: Grundgesetzänderung für Finanzpaket tritt in Kraft
Das riesige Finanzpaket, mit dem der Staat über neue Schulden Milliardenbeträge in Verteidigung und Infrastruktur investieren will, kann in Kraft treten.
Einen Tag nach der Zustimmung des Bundesrates hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes unterzeichnet. Das teilte das Bundespräsidialamt mit. Es muss jetzt nur noch im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden.
22. März, 8.15 Uhr: Vorschlag aus dem Norden: Bekannten Verteilungsschlüssel nutzen
Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (51, CDU) sprach sich im RND und im ZDF-"Heute Journal" dafür aus, die Mittel aus dem Sondervermögen über den sogenannten Königsteiner Schlüssel zu verteilen.
Bei dem Verteilschlüssel wird das Steueraufkommen der Länder zweifach, die jeweilige Einwohnerzahl einfach gewertet. Das Verfahren wird häufig bei Bund-Länder-Finanzierungen genutzt.
22. März, 8.10 Uhr: Rund 100 Milliarden Euro für die Bundesländer
Es wird ein Sondervermögen geschaffen, für das die Schuldenbremse nicht gilt und das mit Krediten bis zu 500 Milliarden Euro gefüttert wird.
Daraus soll die Instandsetzung der maroden Infrastruktur bezahlt werden. 100 Milliarden Euro sollen an die Länder gehen, weitere 100 Milliarden Euro sollen fest in den Klimaschutz und in den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft fließen.
Die Länder dürfen künftig zusammen Schulden in Höhe von 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aufnehmen – das wären in diesem Jahr ungefähr 15 Milliarden Euro. Bisher gilt für die Länder eine Schuldengrenze von null.
22. März, 8.05 Uhr: Söder fordert durchdachte und gesetzlich geregelte Ausgabe der Mittel
Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU, 58) mahnte eine durchdachte und gesetzlich geregelte Ausgabe der Mittel des Sondervermögens an.
"Es ist kein Selbstbedienungsladen für niemanden, sondern es muss durch fachliche Entscheidungen und durch Gesetze begründet werden: Was wird für die Straße, was wird für die Schiene ausgegeben, was wird für die Krankenhäuser ausgegeben. Was ist für Wissenschaft und Forschung wichtig." Dies müsse alles noch entschieden werden, sagte der CSU-Chef dem RND.

21. März, 18.06 Uhr: Grünen-Fraktionsspitze stellt Julia Klöckner ein Ultimatum
Die Grünen wollen von der Unionskandidatin für das Amt der Bundestagspräsidentin, Julia Klöckner (52), genau wissen, ob sie vor der für Dienstag vorgesehenen Wahl auch mit den Abgeordneten der AfD sprechen wird oder nicht.
Von ihrer Antwort will die Spitze der Grünen-Fraktion dann abhängig machen, ob sie Klöckner in ihre eigene Sitzung einlädt oder nicht.
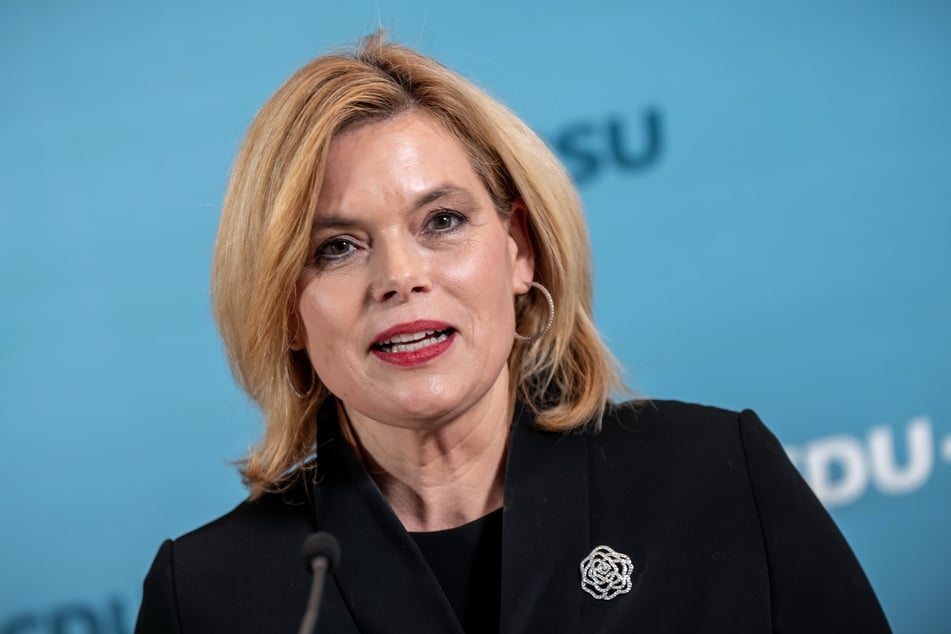
21. März, 11.15 Uhr: Bundesrat stimmt Grundgesetzänderung für Finanzpaket zu
Der Bundesrat hat den Weg für das Milliarden-Finanzpaket von Union und SPD frei gemacht.
Wie schon im Bundestag kam auch in der Länderkammer die nötige Zweidrittelmehrheit für die entsprechende Änderung des Grundgesetzes zustande.

21. März, 10.37 Uhr: AfD scheitert erneut mit Eilantrag gegen Schuldenpaket
Die AfD-Bundestagsfraktion ist am Bundesverfassungsgericht erneut mit einem Eilantrag gegen das Schuldenpaket von Union und SPD erfolglos geblieben.
Diesmal wollte die Fraktion in Karlsruhe erreichen, dass das Gericht dem Bundesrat vorläufig untersagt, den entsprechenden Grundgesetzänderungen zuzustimmen. Der Zweite Senat lehnte den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ab.
Zuvor hatte das Gericht bereits mehrere Anträge – darunter auch zwei der AfD-Fraktion – abgelehnt, mit der die Antragssteller die Verabschiedung des Finanzpakets im Bundestag verhindern wollten. Sie hatten sich darauf berufen, dass der alte Bundestag nicht zu Sondersitzungen hätte einberufen werden dürfen und dass die Beratungszeit nicht ausreiche.

21. März, 7.24 Uhr: Dürr will FDP "optimistisches Lebensgefühl" einhauchen
Der Kandidat für den FDP-Vorsitz, Christian Dürr (47), will den Liberalen nach dem Scheitern bei der Bundestagswahl wieder ein positives Image verpassen.
"Mir ist wichtig, dass wir als Partei Veränderung zulassen und dass mit der FDP ein optimistisches, zukunftsorientiertes Lebensgefühl verbunden wird", sagte der scheidende Fraktionsvorsitzende der "Augsburger Allgemeinen". "Wir müssen die modernste Partei Deutschlands sein."
Die FDP war bei der Bundestagswahl nur auf 4,3 Prozent der Zweitstimmen gekommen und gehört dem künftigen Parlament nicht mehr an. Parteichef Christian Lindner (46) verkündete seinen Rückzug aus der Politik. Dürr bewirbt sich um den Parteivorsitz. Gewählt wird die neue Führung bei einem Bundesparteitag Mitte Mai in Berlin.

21. März, 7.15 Uhr: Kanzler Scholz erklärt, womit viele zu Beginn seiner Amtszeit nicht gerechnet haben
"Tschüss" – mit diesem knappen Wort hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) bei der Pressekonferenz nach seinem wohl letzten regulären EU-Gipfel verabschiedet.
Zum Abschluss des Treffens zog der SPD-Politiker eine sachliche Bilanz seiner Zeit an Brüsseler Gipfeltischen. Er habe in den Jahren "viel gelernt über die politischen Verhältnisse in anderen Ländern", sagte Scholz. Das helfe, "immer locker zu bleiben bei all dem, was einem selbst begegnen kann".
Auf die Frage nach seiner größten Errungenschaft verwies der Kanzler auf die Unterstützung der Ukraine und darauf, dass große Krisen wie die Energiekrise bewältigt worden seien. Dies sei gelungen, obwohl viele anfangs nicht daran geglaubt hätten, sagte Scholz.

20. März, 22.12 Uhr: FDP scheitert mit weiteren Vorstößen gegen Votum im Bundesrat
Mehrere Landtagsfraktionen der FDP sind vor Gericht mit dem Versuch gescheitert, eine Abstimmung ihrer Landesregierungen im Bundestag zum milliardenschweren Finanzpaket des Bundes zu verhindern.
Das baden-württembergische Verfassungsgericht lehnte am Abend einen Antrag der oppositionellen FDP-Landtagsfraktion gegen die Pläne ab. Auch das nordrhein-westfälische Verfassungsgericht sowie der Strafgerichtshof in Bremen schmetterten die Anträge der dortigen FDP-Landtagsfraktionen ab. Zuvor war das auch in Hessen geschehen.
20. März, 19.37 Uhr: Hessischer Staatsgerichtshof weist FDP-Klage gegen Milliardenpaket ab
Der Hessische Staatsgerichtshof hat eine Klage der FDP-Landtagsfraktion gegen das geplante milliardenschwere Investitionspaket der Bundesregierung abgewiesen.
Die Anträge der Liberalen richteten sich gegen die angekündigte Zustimmung der Mitglieder der Landesregierung zur geplanten Grundgesetzänderung im Bundesrat am Freitag (21. März).
Das höchste hessische Gericht begründete seine Entscheidung in Wiesbaden mit der fehlenden Antragsbefugnis der Landtagsfraktion.

19. März, 19.17 Uhr: Ost-Länderchefs fordern Stärkung von Ostdeutschland
Der Osten Deutschlands muss aus Sicht der ostdeutschen Ministerpräsidenten in einer neuen Bundesregierung personell angemessen vertreten sein.
Der Beauftragte für Ostdeutschland müsse weiterhin mit Kabinettsrang ausgestattet sein, um die strukturellen Unterschiede zwischen Ost und West sichtbar zu halten. Die Union will die Zahl der Regierungsbeauftragten reduzieren und auf den Ostbeauftragten verzichten, die SPD möchte an dem Amt festhalten.
"Zudem erwarten wir, dass Bundesministerinnen und Bundesminister mit ostdeutschem Hintergrund berufen werden", heißt es in einer siebenseitigen gemeinsamen Erklärung der Ost-Ministerpräsidenten. Diese Forderungen müssten in einem neuen Koalitionsvertrag berücksichtigt werden.
Die Erklärung trägt den Titel "Die Zukunftsregion Ostdeutschland gemeinsam gestalten". Darin fordern die Regierungschefs der ostdeutschen Bundesländer Union und SPD auf, bei ihren Koalitionsverhandlungen den Osten Deutschlands als Zukunftsraum nicht aus dem Blick zu verlieren, sondern zu stärken und zu fördern.

19. März, 17.52 Uhr: Scholz reist letztes Mal zu EU-Gipfel
Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) wird an diesem Donnerstag zu seinem voraussichtlich letzten regulären EU-Gipfel in Brüssel erwartet.
Bei dem Frühjahrstreffen der Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten soll es unter anderem um die weitere Unterstützung der Ukraine und Bemühungen für eine dauerhaft wettbewerbsfähige Wirtschaft gehen. Zudem stehen Beratungen zu den neuen israelischen Militäroperationen im Gazastreifen sowie zu den beginnenden Planungen für den nächsten langfristigen EU-Haushalt auf dem Programm.
19. März, 16.42 Uhr: Grünen-Landesvorsitzende rückt für Baerbock in den Bundestag
Die frisch gewählte Landesvorsitzende der Grünen in Brandenburg, Andrea Lübcke (46), wird ihr Amt wieder aufgeben und für Annalena Baerbock (44) in den Bundestag nachrücken.
Lübcke folgt aufgrund ihres Listenplatzes 3 als Nachfolgerin, erklärte ein Sprecher des Landesverbands. Baerbock ist Kandidatin für den Vorsitz der UN-Generalversammlung, daher wird ihr Bundestagsplatz frei. Sie soll im Juni gewählt werden.
19. März, 16.03 Uhr: Klöckner gibt Amt als CDU-Schatzmeisterin ab
Die CDU-Politikerin Julia Klöckner (52) gibt vor ihrer vorgesehenen Wahl zur Bundestagspräsidentin ihre Funktion in der Parteiführung ab.
Ihr Amt als Bundesschatzmeisterin der CDU lege sie am kommenden Montag in den Gremiensitzungen nieder, sagte Klöckner der Deutschen Presse-Agentur. Dies habe sie vor ihrer Nominierung mit CDU-Chef Friedrich Merz bereits besprochen.

19. März, 14.45 Uhr: Sonderschichten und Stühlerücken im Parlament
Bauarbeiten im Bundestag: Nach der Sondersitzung des alten Bundestags am Dienstag wird der Plenarsaal für die konstituierende Sitzung des 21. Deutschen Bundestags am kommenden Dienstag umgebaut.
Sowohl die Bestuhlung als auch die Tische werden entsprechend der neuen Sitzverteilung angepasst, sagte Dirk Wagner, Leiter des Hochbau-Referats der Bundestagsverwaltung.
"Das heißt, wir bauen in den ersten sechs Reihen, wo sich vor den Stühlen auch Tische befinden, die Tische um und wir stecken entsprechend der neuen Sitzverteilung hier im Plenarsaal die komplette Bestuhlung neu." Außerdem würden die IT-Anlagen angepasst. Für die Mikrofone und Telefone müssen deswegen etwa Kabelzüge neu verlegt werden.
Im alten Parlament saßen nach Angaben der Bundestagsverwaltung zuletzt 733 Abgeordnete. Aufgrund der Wahlrechtsreform werden ab kommenden Dienstag mit der konstituierenden Sitzung nur noch 630 Abgeordnete von CDU/CSU, AfD, SPD, Grünen und Linken im Plenum vertreten sein.
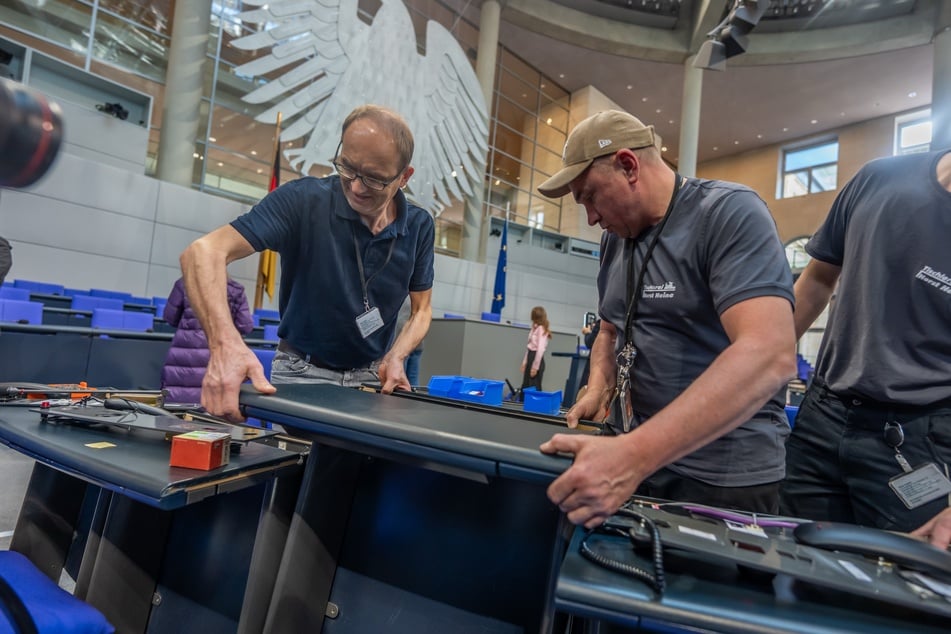
19. März, 13.18 Uhr: Verteidigungsminister Pistorius äußert sich zu seiner Zukunft
Nach Angaben von Verteidigungsminister Boris Pistorius (65, SPD) ist bisher offen, ob er nach einer Regierungsbildung weiter im Amt bleibt.
"Das ist noch nicht klar", antwortete der SPD-Politiker auf eine entsprechende Frage im ZDF. Pistorius hatte in der Vergangenheit wiederholt deutlich gemacht, dass er auch bei einem Regierungswechsel gerne Verteidigungsminister bleiben würde. Derzeit verhandeln Union und SPD über die Bildung einer Koalition.
Pistorius wies Befürchtungen zurück, dass mit dem beschlossenen Milliardenpaket für Verteidigung und Infrastruktur unbegrenzt Geld ausgegeben werden könne: "Von der Schuldenbremse ausgenommen heißt nicht unbegrenzte Mittel", so der Minister. Die Bundesregierung müsse jedes Jahr einen Haushaltsplan vorlegen. Am Ende entscheide das Parlament über die Höhe der Verteidigungsausgaben, und dazu zählten auch Ausgaben für die zivile Verteidigung.

19. März, 8.01 Uhr: Annahme des gigantisches Finanzpakets sorgt für Dax-Rekord
Die Aussicht auf milliardenschwere Investitionen in Infrastruktur und Rüstung hat den deutschen Aktienmarkt am Dienstag weiter angetrieben.
Schon bevor der Bundestag am Nachmittag grünes Licht für das Finanzpaket gegeben hatte, war der Dax auf ein Rekordhoch bei gut 23.476 Punkten gestiegen. Letztlich ging der deutsche Leitindex 0,98 Prozent im Plus mit 23.380,70 Zählern aus dem Handel. Sein Jahresgewinn liegt er mittlerweile bei mehr als 17 Prozent.
Das vom Bundestag genehmigte Finanzpaket mache den Unternehmen nun deutlich, dass das Geld bereitliege, kommentierte Thomas Gitzel von der VP Bank. "Das gibt Verlässlichkeit und Unternehmen können ihrerseits wiederum in entsprechende Maschinen und Kapazitätserweiterungen investieren." Allerdings muss am Freitag zunächst auch noch der Bundesrat dem Paket zustimmen.

18. März, 19.53 Uhr: Das sagt Kanzler Scholz jetzt zum Milliarden-Finanzpaket
Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) hat den Bundestagsbeschluss für ein Milliarden-Finanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur als wichtigen deutschen Beitrag angesichts der aktuellen Herausforderungen für Europa hervorgehoben.
Das Parlament habe in einer "historischen Entscheidung die Voraussetzung dafür geschaffen, dass Deutschland seiner Verantwortung gerecht wird", sagte der SPD-Politiker am Abend bei einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron (47) in Berlin.
"Mit gleich drei Änderungen des Grundgesetzes lösen wir die Fesseln, die uns bislang daran gehindert haben, ausreichend Finanzmittel für unsere Verteidigung auszugeben", fügte Scholz hinzu. "Diese Beschlüsse sind wichtig, sie sind richtig und sie sind angemessen."

18. März, 17.52 Uhr: Diese Abgeordneten stimmten gegen das Schuldenpaket
Die erforderliche Zweidrittelmehrheit für das Schuldenpaket von Union, SPD und Grünen lag bei 489 Stimmen. Diese ist im Bundestag mit 512 Ja-Stimmen deutlich übertroffen worden.
Innerhalb von Union, SPD und Grünen, die sich zuvor in zähen Verhandlungen auf das Vorhaben geeinigt hatten, gab es lediglich drei Abweichler, die mit Nein stimmten: Jan Dieren (SPD), Mario Czaja (49, CDU) und Canan Bayram (Grüne). Das geht aus einer nach der namentlichen Abstimmung vom Bundestag veröffentlichten Liste hervor.
Sieben weitere Abgeordnete gaben ihre Stimme nicht ab, weil sie zum Beispiel aus Krankheits- oder anderen Gründen oder auch bewusst nicht teilnahmen: Nezahat Baradari (SPD), Ronja Kemmer (CDU), Jens Koeppen (CDU), Tessa Ganserer (Grüne), Sabine Grützmacher (Grüne), Tabea Rößner (Grüne), Beate Walter-Rosenheimer (Grüne).

18. März, 16.30 Uhr: Wirtschaft sieht Union und SPD jetzt in großer Verantwortung
Wirtschaftsverbände sehen die mögliche neue Bundesregierung aus Union und SPD nach dem Beschluss des Bundestags für ein milliardenschweres Kreditpaket in einer großen Verantwortung.
"Dieses Verschuldungspaket kann nur funktionieren, wenn die neue Regierung die strukturellen Probleme in unserem Land konsequent angeht und dringend notwendige Reformen umsetzt – sonst versandet das Geld", sagte Peter Adrian, Präsident der Deutsche Industrie- und Handelskammer. "Quälend lange Genehmigungsprozesse, veraltete Verwaltungen, marode Infrastruktur, hohe Steuern und lähmende Bürokratie müssen endlich der Vergangenheit angehören."
Die Milliarden müssten klug und effizient eingesetzt werden, so Adrian.

18. März, 16.07 Uhr: FDP-Landtagsfraktionen wollen Milliardenpaket stoppen
Mehrere FDP-Landtagsfraktionen wollen die Zustimmung des Bundesrats zum milliardenschweren Finanzpaket und zur Aufweichung der Schuldenbremse verhindern.
Dafür kündigten die FDP-Fraktionen in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg und Bremen Klagen vor den jeweiligen Landesverfassungsgerichtshöfen an. Sie wollen so im letzten Moment die Zustimmung ihrer Landesregierungen zur geplanten Änderung des Grundgesetzes im Bundesrat am Freitag verhindern.
18. März, 16.01 Uhr: Erleichterung bei Union und SPD - Ja für Milliarden-Kreditpaket!
Der Bundestag hat dem hunderte Milliarden Euro schweren Schuldenpaket für Verteidigung und Infrastruktur zugestimmt.
Bei der Abstimmung am Dienstag erreichten die von Union, SPD und Grünen vereinbarten Änderungen des Grundgesetzes die erforderliche Zweidrittelmehrheit. Für das Votum war der Bundestag nochmals in seiner alten Zusammensetzung zusammengekommen.

18. März, 14.32 Uhr: Debatte beendet, Abstimmung beginnt
Im Bundestag beginnt in Kürze die Abstimmung über verschiedene Gesetzesentwürfe sowie das milliardenschwere Finanzpaket.
Es braucht eine Zweidrittelmehrheit. Mit einem Ergebnis wird gegen 16 Uhr gerechnet.
18. März, 14.53 Uhr: Linke-Gruppenchef warnt vor Blankoscheck für Aufrüstung
Der Vorsitzende der Gruppe die Linke im Bundestag, Sören Pellmann (48), hat die geplante Grundgesetzänderung zur Lockerung der Schuldenbremse als "Blankoscheck für unbegrenzte Aufrüstung" kritisiert.
CDU-Chef Friedrich Merz (69) führe das Land damit "ins Unheil", kritisierte Pellmann, der im nächsten Bundestag zusammen mit Heidi Reichinnek die Linke wieder in Fraktionsstärke anführen wird.
18. März, 14.20 Uhr: Linke wirft Merz "unsoziale und verlogene" Politik vor
Die Linkspartei hat CDU-Chef Friedrich Merz (69) mit Blick auf das geplante milliardenschwere Finanzpaket eine "unsoziale und verlogene" Politik vorgeworfen.
Mit der "geschürten Angst vor Bedrohung und Krieg" würden mit einer gigantischen Aufrüstungsverschuldung die Probleme von morgen geschaffen, sagte der Gruppenvorsitzende der Linken, Sören Pellmann (48), am Dienstag im Bundestag.
"Das ist nicht das Agieren eines verantwortungsvollen künftigen Kanzlers, sondern eines politischen Hasardeurs", fuhr Pellmann fort. Er kritisierte es vor diesem Hintergrund als "Schamlosigkeit", dass der Bundestag noch einmal in alter Besetzung einberufen wurde, um die für die Gesetzesänderungen nötige Zweidrittelmehrheit zu erhalten. Pellmann warnte zudem vor Einschnitten in den Sozialstaat, um die horrenden Schulden zu finanzieren.
BSW-Chefin Sahra Wagenknecht (55) brandmarkte die Finanzpläne als "Kriegskredite mit Klimasiegel" - und spielte darauf an, dass im Zuge der Grundgesetzänderungen auch das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 mit festgeschrieben werden soll. Auch Wagenknecht warnte vor den Folgen der Milliardenverschuldung, etwa für alte Menschen, Familien und Unternehmen. Das BSW werde sich "diesem gefährlichen Weg mit aller Kraft entgegenstellen".

18. März, 13.51 Uhr: BSW macht Abgang mit Protestaktion
Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat bei der Sitzung des Bundestags am Dienstag Ordnungsrufe der Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau (61) aufgrund einer Plakataktion kassiert.
Nach wenigen Sekunden rollte die Fraktion die Transparente mit der Aufschrift "1914 wie 2025: NEIN zu Kriegskrediten!" wieder ein.

18. März, 13.30 Uhr: Grüne wollen auf sinnvolle Investitionen achten
Die Grünen wollen nach Angaben ihrer Co-Vorsitzenden Franziska Brantner (45) sehr genau darauf achten, dass die geplanten Milliardenkredite nicht zweckentfremdet werden.
"Wir werden darauf achten, dass dieses Geld sinnvoll investiert wird", versprach Brantner bei der Sondersitzung des Bundestags.
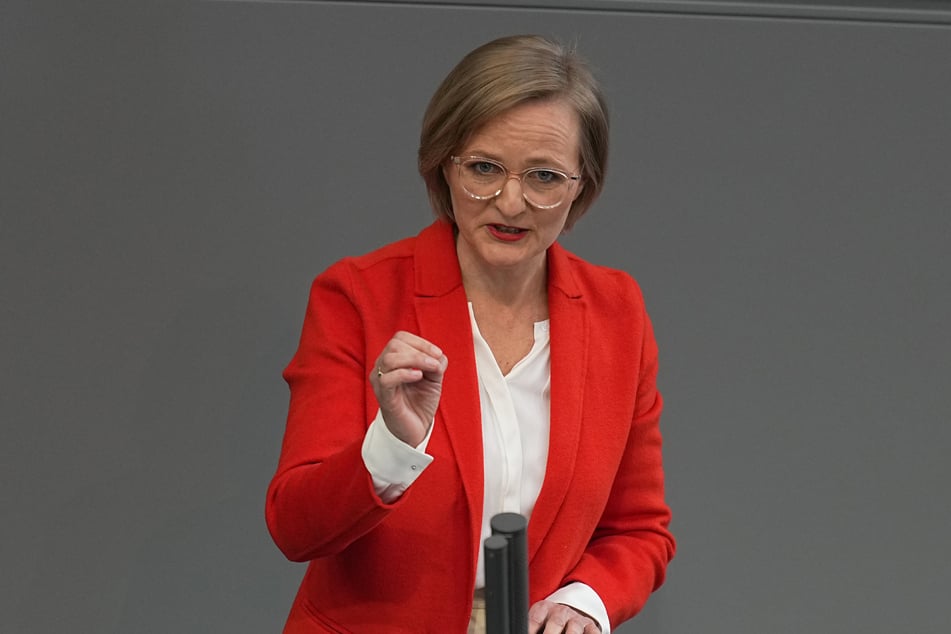
18. März, 13.14 Uhr: Kampf um Finanzpaket! Scharfe Kritik von FDP und AfD
In einer emotionalen Debatte hat der Bundestag die Pläne für das historische Milliarden-Finanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur diskutiert.
Unions-Fraktionschef Friedrich Merz (69, CDU) rechtfertigte die geplanten Milliardenschulden mit der Sicherheit Deutschlands, Europas und der Nato. SPD-Fraktionschef Lars Klingbeil (47) warb mit Vorteilen der geplanten Investitionen für Bürgerinnen und Bürger.
Scharfe Kritik kam hingegen von FDP und AfD. FDP-Fraktionschef Christian Dürr (47), dessen Partei dem nächsten Bundestag nicht mehr angehören wird, warf der Union vor, sich gegen wirtschaftlichen Erfolg des Landes zu entscheiden. "Viel Geld, keine Reformen. Das wird Ihre Kanzlerschaft kennzeichnen", sagte Dürr an Merz gewandt. Der AfD-Fraktionsvorsitzende Tino Chrupalla (49) warf Merz vor, nicht nur kein Rückgrat zu haben, sondern inzwischen "komplett wirbellos" zu sein. "Hier soll planlos die Staatsverschuldung in den Himmel getrieben werden", bemängelte er.
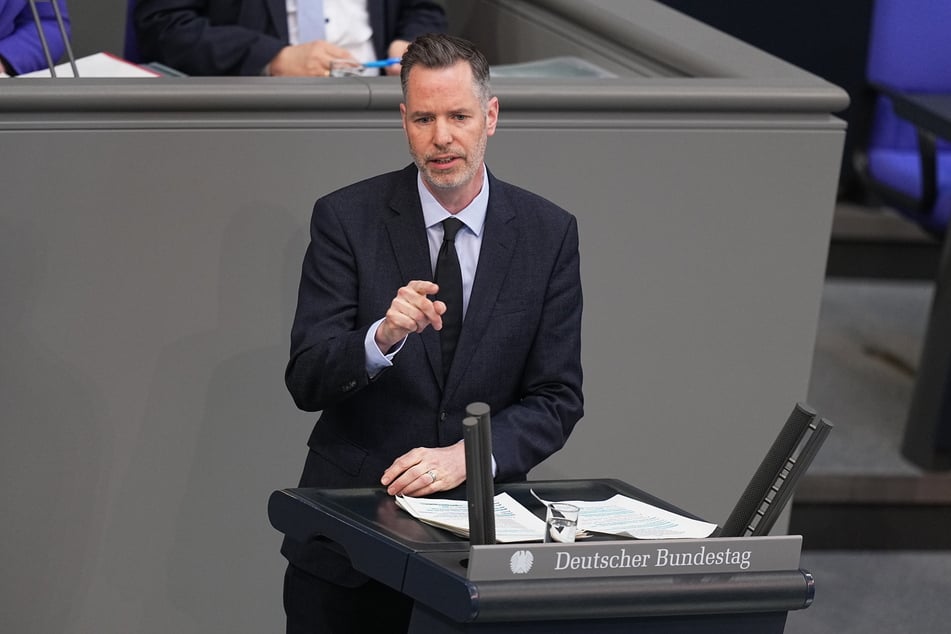

18. März, 13.04 Uhr: Ministerpräsident: Länder brauchen das Finanzpaket
Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (51, SPD) hat die Bedeutung des geplanten, milliardenschweren Kreditpakets für die Bundesländer betont.
Die Ausweitung der Schuldenregel helfe den Ländern, für gute Kitas, Schulen, Hochschulen, Verkehrswege, Mobilität und Zukunftsregionen zu sorgen, sagte der SPD-Politiker in einer Sondersitzung des Bundestags. Teil des Pakets ist ein höherer Schuldenspielraum für die Länder. Künftig sollen sie zusammen Kredite in Höhe von 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aufnehmen dürfen.

18. März, 12.51 Uhr: Finanzpakete laut Dobrindt Signal an Russland und die USA
CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt (54) verteidigt die riesigen Schuldenpakete für Verteidigung und Infrastruktur als Signal der politischen Mitte für ein sicheres Europa und ein wirtschaftlich stabiles Deutschland.
Wenn Union, SPD und Grünen keinen Kompromiss gefunden hätten, gäbe es "massive Zweifel an der politischen Handlungsfähigkeit in unserem Land", sagte der Vorsitzende der CSU-Parlamentarier im Bundestag vor der Abstimmung über das gemeinsam geplante Finanzpaket. Er fügte hinzu: "Es gäbe in Europa Angst vor weiteren Aggressionen Russlands, und es gäbe in Russland die Erkenntnis, dass der Westen zu schwach ist, um sich zu wehren."

18. März, 12.45 Uhr: Grünen-Fraktion entscheidet Montag über Vize-Kandidatur
In einer geheimen Abstimmung sollen die Abgeordneten der Grünen-Fraktion am Montag klären, wer aus ihren Reihen für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten kandidieren darf.
"Wir werden ganz in Ruhe am Montag dann die Wahl durchführen", sagte die Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann (63) am Dienstag vor Journalisten auf Nachfrage. Wenn mehrere Abgeordnete an einer Kandidatur interessiert seien, werde es hierzu in der Fraktionssitzung eine geheime Abstimmung geben.
18. März, 12.12 Uhr: Pistorius betont Dringlichkeit der Verteidigungsausgaben
Verteidigungsminister Boris Pistorius (65) hat die Dringlichkeit der geplanten Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben betont.
"Wer heute zaudert, wer sich heute nicht traut, wer meint, wir könnten uns diese Debatte noch über Monate leisten, der verleugnet die Realität", sagte der SPD-Politiker in der Sondersitzung im Bundestag. Die Sicherheit und die Zukunft des Landes hingen davon ab.

18. März, 12.06 Uhr: Merz laut Chrupalla "würdelos"
AfD-Fraktionschef Tino Chrupalla (49) wirft Unionsfraktionschef Friedrich Merz (69, CDU) vor, "würdelos" zu sein.
Bei einer Rede im Bundestag am Dienstag sagte er, gerichtet an Merz: "Sie finanzieren ihre Machtoption über Schulden." Dabei beschwerte sich darüber, dass die Investitionen im geplanten Finanzpaket nicht zielgerichtet seien.
18. März, 11.46 Uhr: Dürr warnt vor "Schuldenkoalition"
FDP-Fraktionschef Christian Dürr (47) mahnt, dass die massive Verschuldung durch das Finanzpaket "als Startschuss für hemmungslose Schuldenmacherei" gilt.
Bei einer Rede im Bundestag am Dienstag warnte er: "Statt einer Großen Koalition haben wir jetzt eine SchuKo, eine Schuldenkoalition, die den Wohlstand von morgen für kurzfristige Wahlgeschenke bereit ist zu opfern."
18. März, 11.30 Uhr: Grünen-Fraktionschefin gibt Merz bissig Konter
Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann (63) hat die Union im Bundestag scharf angegriffen - die geplante Zustimmung ihrer Fraktion zum Finanzpaket aber mit der Verantwortung für das Land begründet.
Alle hätten bereits im vergangenen Jahr gewusst, dass Deutschland dringend Investitionen und zugleich mehr Geld für die Verteidigung brauche - auch CDU-Chef Friedrich Merz, argumentierte Haßelmann in der Sondersitzung in Berlin. Merz und seine Partei aber hätten das öffentlich nie zugegeben und die Grünen sogar noch für entsprechende Forderungen diffamiert.
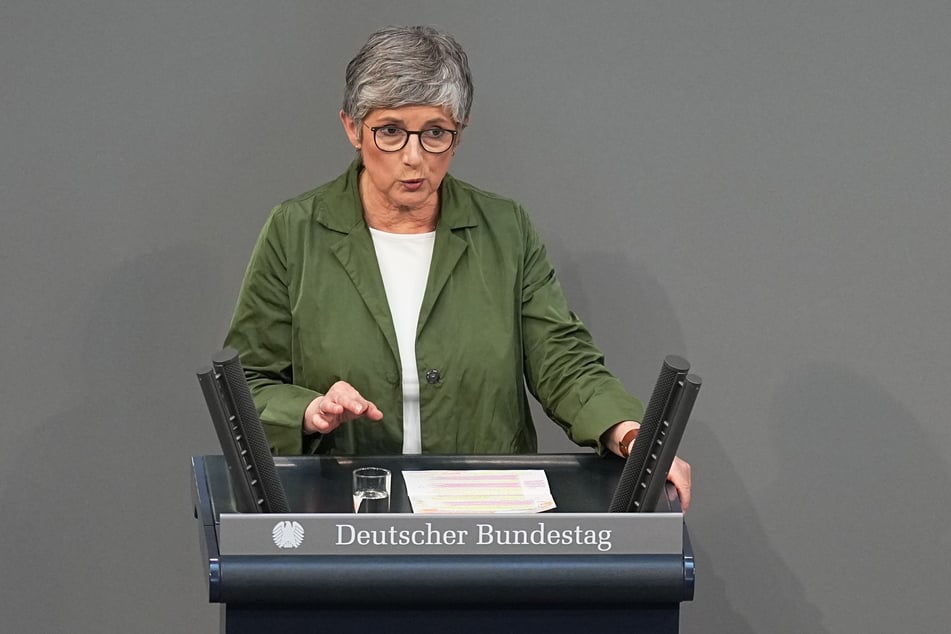
18. März, 11.25 Uhr: Größere Verschuldung verlangt laut Merz erhebliche Einsparungen
Unionsfraktionschef Friedrich Merz (69) sieht Deutschland angesichts der geplanten riesigen neuen Schuldenpakete für Verteidigung und Infrastruktur vor einschneidenden Sparmaßnahmen.
Die möglich werdenden Investitionen in die Infrastruktur "verringern auch nicht den Konsolidierungsbedarf der öffentlichen Haushalte. Das Gegenteil ist richtig", sagte der wohl künftige Kanzler im Bundestag vor der Abstimmung über das von Union, SPD und Grünen geplante Finanzpaket.
18. März, 11.07 Uhr: Deutschland braucht laut Klingbeil "grundlegende Modernisierung"
SPD-Chef Lars Klingbeil (47) hält neben Milliarden-Investitionen eine grundlegende Modernisierung des Landes für nötig.
Geld alleine könne die Herausforderungen, vor denen das Land stehe, nicht lösen, sagte Klingbeil in der Sondersitzung des Bundestags. "Wir müssen überall effizienter, zielgenauer und professioneller werden." Es brauche dringend Reformen, die die SPD in einer künftigen Bundesregierung gemeinsam mit der Union angehen wolle. Bürokratie müsse zurückgebaut werden, dafür brauche es einen "Mentalitätswechsel", sagte Klingbeil.
18. März, 11.05 Uhr: Merz verteidigt riesiges schwarz-rotes Schuldenprogramm
Unionsfraktionschef Friedrich Merz (69, CDU) hat das geplante riesige Schuldenprogramm für Verteidigung, Infrastruktur und Klimaschutz mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und damit gegen Europa verteidigt.
"Für eine solche Verschuldung lässt sich nur unter ganz bestimmten Umständen und unter ganz bestimmten Bedingungen überhaupt eine Rechtfertigung finden", sagte der wohl künftige Kanzler im Bundestag vor der Abstimmung über das von Union, SPD und Grünen vereinbarte Milliarden-Finanzpaket. Zugleich kritisierte er scharf die AfD. Man habe nichts mit deren Weltbild gemein.
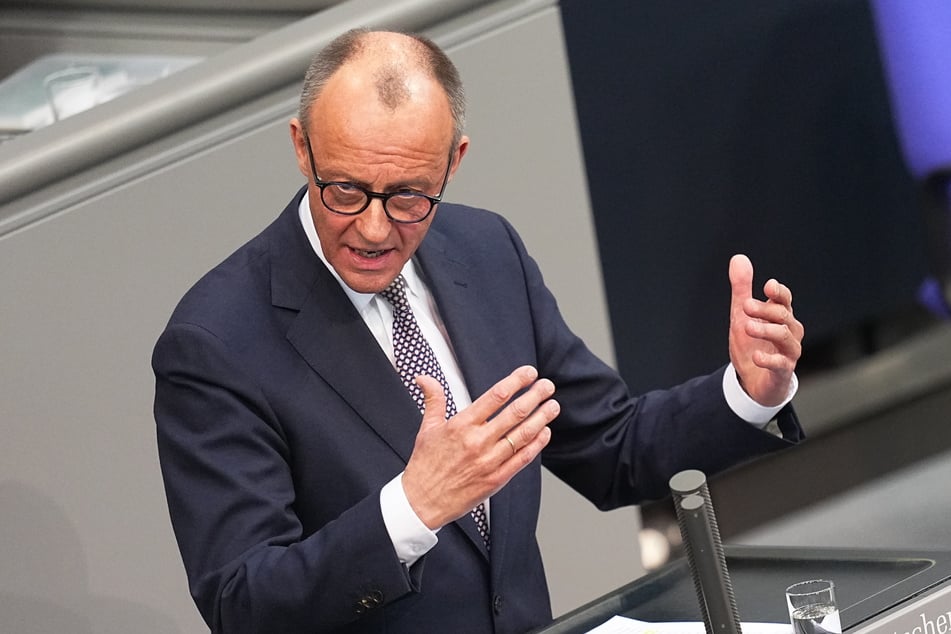
18. März, 11.03 Uhr: Laut Klingbeil Investition in Stärke unseres Landes
SPD-Fraktionschef Lars Klingbeil (47) erwartet durch das geplante, milliardenschwere Kreditpaket einen Aufbruch für Deutschland und Europa.
"Wir investieren in die Stärke unseres Landes", betonte Klingbeil in einer Sondersitzung des Bundestags. Mit dem Paket übernehme Deutschland mehr Verantwortung für Sicherheit, Frieden und Wohlstand in Europa. Es werde die Mehrheit der Menschen in ihrem Alltag entlasten, das wirtschaftliche Wachstum ankurbeln und die Sicherheit stärken.

18. März, 10.55 Uhr: Bundestag lehnt Anträge auf Absetzen der Debatte ab
FDP und AfD sind mit dem Versuch gescheitert, in letzter Minute die entscheidende Sitzung des Bundestags zum Milliarden-Finanzpaket von Union und SPD zu kippen.
CDU, CSU, SPD und Grüne lehnten die Anträge ab, die geplante Änderung des Grundgesetzes in mehreren Punkten von der Tagesordnung zu nehmen. "Hier soll das Grundgesetz geändert werden in einem dramatischen Schweinsgalopp", sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Johannes Vogel (42). "Mit einem seriösen parlamentarischen Verfahren hat das nichts zu tun."
18. März, 10.35 Uhr: Mehrheit für Schuldenpaket steht anscheinend schon!
Die von Union, SPD und Grünen angestrebte Zweidrittelmehrheit für das Schuldenpaket im Bundestag scheint nach Angaben von Vertretern der drei Fraktionen zu stehen.
Die SPD-Fraktion wird nach den Worten von Generalsekretär Matthias Miersch (56) so gut wie geschlossen dafür stimmen. "Wir haben einen Krankheitsfall und eine Person, die dagegen stimmen wird, ansonsten werden wir geschlossen für dieses Paket stimmen", sagte Miersch vor der Bundestagssondersitzung im Sender "phoenix". Was man hier mache, sei historisch, fügte er hinzu.
Bei den Grünen fehlen nach Angaben von Fraktionschefin Britta Haßelmann (63) fünf Stimmen. Bei der Union gibt es nach Angaben von Fraktionschef Friedrich Merz (69, CDU) vom Montag zwei bis drei Abgeordnete, die nicht zustimmen wollen. Der CDU-Abgeordnete Philipp Amthor (32) sagte bei "phoenix", es handele sich um "einige sehr, sehr, sehr wenige Abgeordnete". Er sprach von einer großen Geschlossenheit in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.
Für die benötigte Zweidrittelmehrheit brauchen Union, SPD und Grüne 489 Ja-Stimmen. Zusammen kommen sie auf 520 - 31 mehr als nötig. Zumindest rechnerisch wäre die Mehrheit den Angaben aus den drei Fraktionen zufolge mit mehr als 20 Stimmen gesichert. Überraschungen sind aber immer möglich. Das Ergebnis der namentlichen Abstimmung wird für den frühen Nachmittag erwartet.



18. März, 10.19 Uhr: Ukraine-Hilfe könnte laut Merz am Freitag freigegeben werden
Unionsfraktionschef Friedrich Merz (69, CDU) hat angekündigt, dass die geplante zusätzliche Aufstockung der Ukraine-Hilfe um drei Milliarden Euro nach einer Zustimmung zum geplanten Finanzpaket in Bundestag und Bundesrat an diesem Freitag freigegeben werden soll.
Das erklärte der voraussichtlich künftige Kanzler nach Teilnehmerangaben am Vormittag in einer Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag in Berlin. Dies werde die erste direkte Folge der heute geplanten Bundestagsentscheidung sein. Zuvor habe Merz heute Morgen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) gesprochen, hieß es.
Mehr zum Ukraine-krieg lest ihr hier.
18. März, 10.13 Uhr: Bundestagspräsidentin eröffnet Sitzung
Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (56) hat die 214. Sitzung des Deutschen Bundestages eröffnet.
Bas erinnerte zunächst an den 35. Jahrestag der ersten freien Wahl der Volkskammer in der DDR. Gästin ist die damalige Präsidentin der Volkskammer, Sabine Bergmann-Pohl.
18. März, 9.55 Uhr: Grünen-Fraktion rechnet mit 112 Ja-Stimmen
Die Grünen-Fraktionsspitze rechnet bei der Abstimmung über das Finanzpaket im Bundestag mit einer breiten Zustimmung aus den eigenen Reihen.
Die Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann (63) sagte kurz vor der Debatte im Plenum: "Es wird eine Person geben, die angekündigt hat, mit Nein zu stimmen." Vier Abgeordnete der Grünen seien krank, ansonsten gebe es große Unterstützung. Auf die Frage eines Journalisten, ob somit 112 Ja-Stimmen aus den Reihen der Grünen zu erwarten seien, antwortete sie: "Davon gehe ich aus."

18. März, 9.25 Uhr: Wann wird über das milliardenschwere Schuldenpaket entschieden?
Am Dienstag entscheidet der Bundestag in einer namentlichen Abstimmung über eine Reform der Schuldenbremse sowie ein milliardenschwere Finanzspritze.
Laut Tagesordnung der 214. Sitzung des Deutschen Bundestages geht es um 10 Uhr los. Verfolgen könnt ihr die Debatte etwa bei YouTube.
18. März, 9.02 Uhr: Sachsens MP Kretschmer macht sich Sorgen um Abstimmung
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) blickt mit einem "mulmigen Gefühl" auf die Bundestagsabstimmung über die milliardenschwere Finanzspritze.
500 Milliarden Euro Investitionen in Infrastruktur und Klimaneutralität. Obendrauf kommen zusätzliche Schulden in Milliardenhöhe für eine verteidigungsfähige Bundeswehr. Angesichts solcher "riesigen Beträge" habe jeder ein "mulmiges Gefühl", erklärte Kretschmer im Interview mit dem RBB-Radiosender "radioeins" am Montagnachmittag.
Mehr dazu lest ihr hier.

18. März, 8.42 Uhr: Höhepunkt im Parlament - Abstimmung über enormes Schuldenpaket
Der alte Bundestag soll heute über das von Union, SPD und Grünen ausgehandelte enorme Schuldenpaket abstimmen, mit dem Milliarden-Investitionen möglich werden sollen.
Bei dem Gesetzespaket geht es um eine Lockerung der Schuldenbremse im Grundgesetz, die vereinfacht gesagt vorschreibt, dass Bund und Länder ohne zusätzliche Kredite mit dem Geld auskommen müssen, was sie einnehmen.
Wegen der schwächelnden Wirtschaft und der internationalen Lage - Stichwort Ukraine - sollen hier nun Ausnahmen geschaffen werden: Für Verteidigungsausgaben, Zivilschutz, Nachrichtendienste und Cybersicherheit sollen unbegrenzte Kredite möglich werden, und für zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur (u.a. Schienen, Brücken, Straßen) wird ein 500-Milliarden-Euro Sondertopf ("Sondervermögen") eingerichtet, der mit Krediten gefüttert wird.


17. März, 22.29 Uhr: Weitere Eilanträge gegen Finanzpaket ohne Erfolg
Weitere Versuche, den am Dienstag geplanten Beschluss des Bundestags über das milliardenschwere Finanzpaket auf rechtlichem Weg zu stoppen, sind in Karlsruhe gescheitert.
Das Bundesverfassungsgericht verwarf mehrere Eilanträge gegen die geplante Abstimmung, wie das höchste deutsche Gericht am Abend mitteilte. Darunter waren Anträge von Bundestagsabgeordneten von AfD, Linke, FDP und dem BSW.

17. März, 20.14 Uhr: Merz rechnet fest mit Zweidrittelmehrheit
Unionsfraktionschef Friedrich Merz (69, CDU) rechnet trotz einzelner Abweichler in den eigenen Reihen mit der nötigen Zweidrittelmehrheit für das von Union, SPD und Grünen vereinbarte Finanzpaket mit Schulden für Investitionen in Infrastruktur, Klimaschutz und Verteidigung.
"Ich habe keinen Zweifel daran, dass das gelingt morgen, aber ich habe natürlich Respekt vor der Abstimmung", sagte der CDU-Chef nach einer Fraktionssitzung von CDU und CSU in Berlin vor dem geplanten Votum im Bundestag.
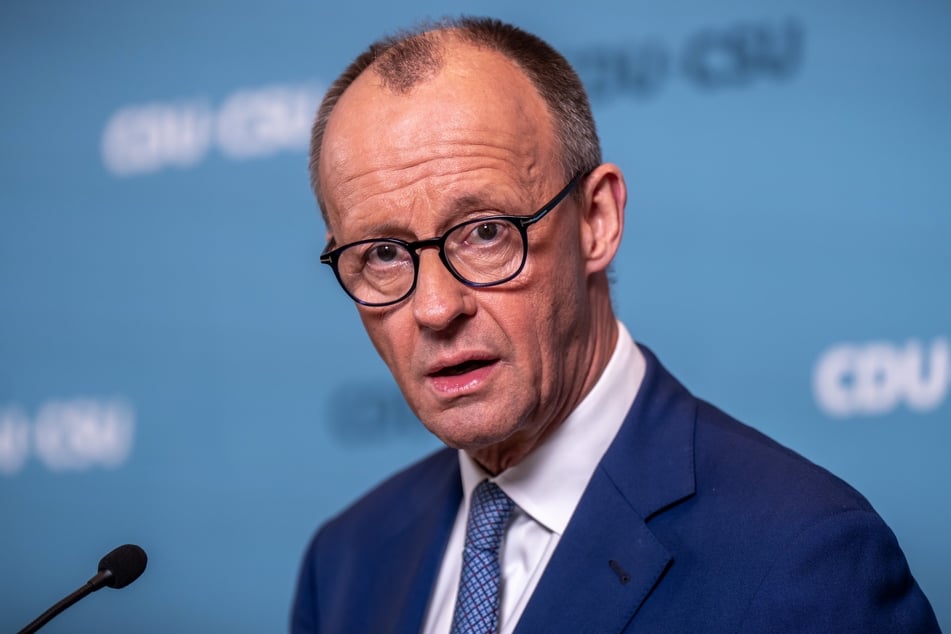
17. März, 19.04 Uhr: Bayern will im Bundesrat für Schuldenpaket stimmen
Bayern will im Bundesrat der Grundgesetzänderung für das geplante milliardenschwere Finanzpaket von Union und SPD zustimmen.
Darauf hätten sich CSU und Freie Wähler in einer Sitzung des Koalitionsausschusses verständigt, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (53, CSU) bei einem gemeinsamen Statement mit Freie-Wähler-Fraktionschef Florian Streibl (61) in der Staatskanzlei in München.
17. März, 19.02 Uhr: Stand jetzt eine Nein-Stimme aus der SPD
SPD-Fraktionschef Lars Klingbeil (47) hat sich zuversichtlich gezeigt, dass das milliardenschwere schwarz-rote Finanzpaket trotz möglicher Abweichler an diesem Dienstag im Bundestag die erforderliche Zweidrittelmehrheit erreichen wird.
"Ich bin optimistisch, dass wir morgen die Grundgesetzänderung erreichen werden und dass wir dann zügig in den Koalitionsverhandlungen vorankommen", sagte Klingbeil vor einer Sitzung seiner Bundestagsfraktion.
Derzeit sei der Stand, dass von den 207 SPD-Abgeordneten einer krankheitsbedingt fehlen und es eine Nein-Stimme geben werde. Es würden jedoch noch Gespräche geführt mit dem Ziel, "dass wir da noch besser werden als SPD-Fraktion".

17. März, 16.31 Uhr: Neuer Bundestag wird nicht vor dem 25. März einberufen
Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (56, SPD) hat einen Antrag der AfD abgelehnt, bereits bis Dienstag um 08.00 Uhr den neuen Bundestag einzuberufen.
Da darüber im künftigen Parlament kein Konsens herrsche, halte sie sich an den Wunsch der Mehrheit von Union und SPD und bleibe beim für den 25. März anvisierten Termin, schrieb Bas an den parlamentarischen Geschäftsführer der AfD, Bernd Baumann (67). Das entspreche der Linie, die das Bundesverfassungsgericht vergangene Woche vorgegeben habe.
17. März, 15.23 Uhr: Freie Wähler können Finanzpaket nach eigener Aussage nicht mehr verhindern
Die Freien Wähler werden nach Worten von Parteichef Hubert Aiwanger (54) die bayerische Zustimmung für das geplante Milliarden-Schuldenpaket von Union und SPD im Bundesrat nicht verhindern können – selbst wenn sie wollen würden.
Man habe "eh keine Chance", dieses endgültig aufzuhalten, räumte Aiwanger ein. "Auch wenn das völliger Wahnsinn ist: Die CSU kann auch ohne uns im Bundesrat zustimmen." Die Sätze fielen am Wochenende bei einem Starkbierfest der Freien Wähler in Neuburg, die "Augsburger Allgemeine" berichtete darüber. Aiwanger bestätigte die Zitate am Montag, vor der wohl entscheidenden Sitzung des Koalitionsausschusses von CSU und Freien Wählern, der Deutschen Presse-Agentur in München.

17. März, 14.27 Uhr: Linke sieht keine Chance mehr, dass neuer Bundestag sich früher konstituiert
Die Linke hat nach eigener Einschätzung alle juristischen Mittel für eine frühere Einberufung des neuen Bundestags ausgeschöpft.
"Es gibt keinen Antrag, den wir einreichen könnten, damit der Bundestag sich konstituiert", sagte Parteichefin Ines Schwerdtner (36) in Berlin. Sie widersprach damit ausdrücklich dem Bündnis Sahra Wagenknecht.
Mit zwei Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht sowie Anträgen im Vorältestenrat des Bundestags habe man alle zur Verfügung stehenden Hebel genutzt, sagte Schwerdtner. Es sei eine "Legende" und "juristischer Unsinn", dass die Linke gemeinsam mit der AfD eine frühere Konstituierung erzwingen könnte.

17. März, 14.24 Uhr: SPD bereitet Mitgliedervotum zum Koalitionsvertrag vor
Nach einer Einigung mit der Union auf einen Koalitionsvertrag will die SPD ihre Mitglieder innerhalb von zehn Tagen darüber entscheiden lassen.
Teilnehmen können alle SPD-Mitglieder, die bis zum kommenden Sonntag (23. März) um 08.00 Uhr in die Partei eingetreten sind, wie Generalsekretär Matthias Miersch (56) nach einer Sitzung des Parteipräsidiums in Berlin sagte.
17. März, 14.02 Uhr: CDU-Politikerin äußert Bedenken über Zustimmung zu Finanzpaket
Die CDU-Abgeordnete Melis Sekmen (31) aus Mannheim hat vor der heutigen Union-Fraktionssitzung Bedenken über die morgige Abstimmung über das geplante Finanzpaket geäußert.
Sekmen, die im vergangenen Jahr von den Grünen zur CDU gewechselt war, teilte am Montag ihre Gedanken in einem Instagram-Beitrag: "Am Dienstag steht die Entscheidung nun an. Ich gehe zu meiner letzten Bundestagssitzung mit gemischten Gefühlen. Es ist eine schwierige Entscheidung und ganz so gut fühlt sich das nicht an." Sie schrieb, dass sich das Vorhaben von Union und SPD aufgrund der Wahlergebnisse "grotesk" anfühle.
Die 31-Jährige wird im neuen Bundestag nicht mehr vertreten sein, da sie ihren Wahlkreis zwar gewonnen hatte, ihr Vorsprung aufgrund des neuen Wahlrechts jedoch zu gering war. Sekmen fügte an, dass sie nach der Fraktionssitzung erneut Stellung beziehen wolle.

17. März, 13.49 Uhr: Merz will Klöckner als Bundestagspräsidentin vorschlagen
Unionsfraktionschef Friedrich Merz (69, CDU) will die rheinland-pfälzische Abgeordnete Julia Klöckner (52, CDU) in der Sitzung der Unionsfraktion am Nachmittag zur Wahl als künftige Bundestagspräsidentin vorschlagen.
Das kündigte der CDU-Chef nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen in einer Sitzung des Parteivorstands in Berlin an. Zuvor hatten sich schon führende CDU-Vertreter klar hinter eine Kandidatur Klöckners für das Amt gestellt.

17. März, 6.27 Uhr: Mehrere Anträge gegen Sondersitzung noch nicht entschieden
Nach Angaben des Bundesverfassungsgerichts waren am Freitag noch drei Organstreitverfahren und vier Verfassungsbeschwerden wegen der Sondersitzung im Bundestag und der geplanten Grundgesetz-Reform anhängig.
Darunter ist eine der Linken, die ebenfalls das stark beschleunigte Gesetzgebungsverfahren zur Änderung des Grundgesetzes moniert.
Union, SPD und Grüne wollen, dass das Grundgesetz an mehreren Stellen geändert wird: Ausgaben für Verteidigung, Zivilschutz, Nachrichtendienste und Cybersicherheit sollen nur noch bis zu einer Grenze von einem Prozent des Bruttoinlandsprodukts - also gemessen am BIP 2024 etwa 43 Milliarden Euro - unter die Schuldenbremse fallen. Alles darüber hinaus kann aus Krediten bezahlt werden. Die Länder sollen mehr Spielraum für eigene Verschuldung bekommen.
Zudem soll im Grundgesetz ein Sondervermögen für Investitionen in Infrastruktur und Klimaneutralität verankert werden, das von der Schuldenbremse ausgenommen und mit 500 Milliarden Euro aus Krediten gefüttert werden soll.

16. März, 20.20 Uhr: Neue Eilanträge in Karlsruhe gegen Finanzpaket
Mehrere Abgeordnete starten beim Bundesverfassungsgericht einen weiteren Versuch, den für Dienstag geplanten Beschluss des Bundestags über das milliardenschwere Finanzpaket zu verhindern.
Die parteilose Abgeordnete Joana Cotar (51) erhob nach eigenen Angaben zum zweiten Mal Einspruch in Karlsruhe und beantragte, die Abstimmung zu verschieben. Das Verfassungsgericht bestätigte den Eingang. Mit demselben Ziel wollen drei FDP-Abgeordnete einen Eilantrag in Karlsruhe stellen.
16. März, 19.52 Uhr: Söder versichert Zustimmung aus Bayern zu Finanzpaket
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (58, CSU) hat die Zustimmung seines Bundeslands zum geplanten Finanzpaket mit historischen Milliardenkrediten zugesagt.
"Gehen Sie davon aus, dass es an Bayern sicher nicht scheitern wird", sagte der CSU-Chef in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". Später betonte er fast wortgleich: "Gehen Sie mal davon aus, dass Bayern am Ende zustimmen wird."

16. März, 18.49 Uhr: Ex-CDU-Generalsekretär Czaja stimmt Finanzpaket nicht zu
Der ehemalige CDU-Generalsekretär Mario Czaja (49) will dem schwarz-roten Finanzpaket zur Aufnahme neuer Milliardenschulden am Dienstag im Bundestag nicht zustimmen.
"Ich habe meiner Fraktion gegenüber zum Ausdruck gebracht, dass ich dieser Grundgesetzänderung nicht zustimmen kann", sagte der scheidende Berliner Bundestagsabgeordnete dem Nachrichtenportal "ThePioneer". Diese sei "nicht generationengerecht, und die Begründungen, die dafür herangezogen werden, sind nicht redlich".
"Ich hätte das mir nicht vorstellen können, dass wir in so kurzer Zeit eine so wichtige Zusage, die wir bei der Bundestagswahl getroffen haben, nicht mehr bereit sind, umzusetzen", sagte Czaja. Eine "solch grundlegende Änderung zu dem, was man vor der Wahl gesagt hat, nach der Wahl umzusetzen, ist ein sehr hoher Vertrauensverlust in die demokratische Mitte", warnte er.

16. März, 18.01 Uhr: Dürr will FDP-Parteichef werden
Der bisherige FDP-Fraktionschef Christian Dürr (47) will sich für den Parteivorsitz bewerben.
Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus FDP-Kreisen in Berlin.

16. März, 9.56 Uhr: Das sagt Merz zum Vorwurf des Wahlbetrugs
Friedrich Merz (69, CDU) hat in der "Bild am Sonntag" Vorwürfe zurückgewiesen, mit dem Ja zur Reform der Schuldenbremse Wahlbetrug begangen zu haben.
"Ich nehme den Vorwurf ernst, aber ich halte ihn für nicht gerechtfertigt", sagte der CDU-Vorsitzende. "Ich habe aber auch schon vor der Wahl gesagt: Man kann über eine Änderung des Grundgesetzes sprechen", betonte er. "Ich habe das immer mal wieder - auch intern zu meinen Kollegen - gesagt: Lasst uns mal nicht zu sehr darauf fixiert sein, dass wir sie nie und nimmer ändern. In unserem Leben ist nichts für die Ewigkeit", fügte Merz hinzu.
Noch im Juli vergangenen Jahres hatte Merz im ARD-"Morgenmagazin" gesagt: "Die Schuldenbremse, so wie sie im Grundgesetz angelegt ist, ist richtig." Mitte November schloss er als Kanzlerkandidat dann eine Reform der Schuldenbremse nicht mehr aus.
Titelfoto: Bernd von Jutrczenka/dpa
